


International Politics and Society 4/1998
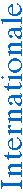
ERNST-OTTO CZEMPIEL
Eine neue Ordnung für Europa
Vorläufige Fassung / Preliminary version
In den zehn Jahren, die seit dem Umbruch von 1990 vergangen sind, hat der Westen kein neues Konzept für die Ordnung des euro-atlantischen Raumes entwickelt. Vieler Anregungen der Politikwissenschaft ungeachtet [1], sind vielmehr alte Vorstellungen und Begrifflichkeiten wiedergekehrt. Von "Sicherheitsarchitektur" wird wieder gesprochen [2], , obwohl sie eine Denkfigur des Kalten Krieges war. Der Einsatz militärischer Gewalt schon wieder als das "letzte Wort", nicht etwa nur das letzte Mittel angepriesen [3], . Eine Analyse der Ursachen, die zum Ende des Ost-West-Konfliktes geführt haben, hat offensichtlich nie stattgefunden; gedankliche Konsequenzen aus diesem Umsturz für eine neue Außenpolitik sind jedenfalls nicht zu erkennen. Auch an der Oberfläche des politischen Bewußtseins hat sich kaum etwas geändert. Das aus der Asche der Sowjetunion hervorgegangene neue Rußland wurde eine Zeit lang als "Partner" des Westens akzeptiert. Inzwischen ist es an die Peripherie der politischen Aufmerksamkeit gerückt. Im amerikanischen Kongreß erscheint seine Rückkehr als imperiale Macht als so wahrscheinlich, daß sie die Beibehaltung der Militärallianz und ihre Osterweiterung rechtfertigt. [4],
Nach wenigen Jahren verschämter Zurückhaltung kehren also in den USA wie in Europa die alten vertrauten Maximen einer Außenpolitik zurück, die sich selbst als Realpolitik ausgibt. Sie wird die vertrauten Resultate produzieren: Antagonismen, Konflikte, Rüstungsspiralen und den Versuch ihrer Bändigung durch Machtgleichgewichte. So muß es nicht kommen, es will eigentlich auch niemand. Aber so wird es kommen, wenn Europa nicht darüber nachdenkt, wie eine moderne, die Ursachen des Zusammenbruchs von Sowjetunion, Warschauer Pakt und Kommunismus reflektierende und die sozioökonomischen Befindlichkeiten der Postmoderne berücksichtigende Außen- und Ordnungspolitik eigentlich aussehen müßte. [5],
Natürlich gibt es kein Grand Design für den gesamten euro-atlantischen Raum. Es kann nur Teilordnungen für die Europäische Union, für die Atlantische Gemeinschaft, für die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und für die Beziehungen zwischen den drei Teilen geben. Aber diese Teilordnungen müssen kompatibel und auf die gleichen Konstruktionsprinzipien aufgebaut sein. Sie zu benennen, ist gar nicht schwer. Die Teilordnungen und die Verbindungen dazwischen müssen so ausgerichtet sein, daß sie die Sicherheit, die Freiheit und die Wohlfahrt der Menschen erzeugen und gewährleisten. Bewußt wird hier als Bezugs- und Maßeinheit nicht der Staat, sondern der Mensch gewählt. Wohlfahrt und Wohlstand werden innerstaatlich verteilt, aber zu einem Großteil im internationalen System erzeugt. Die Entfaltung der bürgerlichen Freiheiten ist auf eine äquivalente internationale Umwelt angewiesen. In dieser Umwelt ist natürlich die Sicherheit einer Gesellschaft zu besorgen; sie hat aber auch längst, wie es der umfassende und erweiterte Sicherheitsbegriff indiziert, eine innenpolitische, eine innergesellschaftliche Dimension erhalten. Der Krieg ist, jedenfalls in Europa, aus dem internationalen System aus- und in die Staaten eingewandert. Als potentielle Gefährdung aber bleibt der Krieg weiterhin bestehen, jedenfalls solange sich die Staaten in einem internationalen System befinden und es nicht, wie die Mitglieder der Europäischen Union, durch ihre Teilintegration bereits verlassen haben.
Dennoch ist es auch in einem internationalen System möglich, diese umfassende Sicherheit der Staaten zu erzeugen. Man muß Strukturen schaffen, die gewährleisten, daß kein Staat den anderen mehr bedroht. Dann, nur dann, sind sie sicher. Sicherheit darf daher nicht, wie es immer wieder gern geschieht, mit Verteidigungsfähigkeit verwechselt werden. Die Staaten des Warschauer Paktes waren absolut verteidigungsfähig, und sie waren gerade nicht sicher. Umgekehrt sind alle entwickelten Industriestaaten, die sogenannten OECD-Staaten, voreinander sicher, obwohl sie keine gegeneinander gerichteten Verteidigungspotentiale unterhalten.
Die europäische Neuordnung muß sich also diesem dreifachen Maßstab stellen. Sie muß insgesamt und in ihren Teilen gewährleisten, daß kein Staat den anderen bedroht, daß alle voreinander sicher sind. Sie muß, zweitens, die Menschen- und Bürgerrechte in einem Ausmaß verwirklichen, das die Zustimmung der Betroffenen findet. Sie muß schließlich, drittens, mit den Werten des wirtschaftlichen Wohlstands ebenso verfahren. Maßeinheit dabei sind stets funktionale Äquivalente. Es geht nicht darum, das westlich-liberale Modell von Demokratie und Marktwirtschaft Kulturen aufzuzwingen, denen es fremd ist. Im euro-atlantischen Bereich, von dem hier die Rede ist, taucht dieses Problem nur im asiatischen Bereich der früheren Sowjetunion auf. Es bleibt den Gesellschaften dort überlassen, wie sie die Freiheit und die Wohlfahrt ihrer Mitglieder erhöhen. Die Neuordnung darf aber nicht verhindern, daß diese Werte erhöht werden, sondern muß diesen Prozeß fördern.
Obwohl die Werte der Sicherheit, der Freiheit und der Wohlfahrt untereinander abhängig sind, so daß sie nur parallel verwirklicht werden können - worauf später noch kurz hingewiesen werden soll -,wird hier jetzt die Erzeugung von Sicherheit in den Vordergrund der Aufmerksamkeit gerückt. Nur wenn sie unter diesem Auswahlgesichtspunkt in die Erscheinung treten, werden Freiheit und Wohlstand ebenfalls erwähnt werden. Das Hauptproblem bei der europäischen Neuordnung ist die Erzeugung jener umfassenden Sicherheit, die auf absehbare Dauer Bestand hat. Der euro-atlantische Bereich hat im ablaufenden Jahrhundert zwei Weltkriege und einen vierzigjährigen Beinahe-Krieg gesehen und sollte vergleichbare Erfahrungen nicht wieder machen müssen. Im Zentrum der Neuordnung muß also die Gewißheit stehen, daß kein Staat des euro-atlantischen Bereiches von einem anderen bedroht werden wird. Das ist ein großes Ziel, aber es ist nicht utopisch. Westeuropa hat von der Mitte des 18. bis zu der des 20. Jahrhunderts den Kriegsherd par excellence abgegeben. Seitdem ist es zu einer ebenso großen Friedenszone geworden. Es ist also nicht unmöglich, auch zwischen ehemaligen Feinden umfassende Sicherheit einzurichten und zu stabilisieren. An diesem Maßstab müssen sich die existierenden Teilordnungen und die Pläne zu ihrer Weiterentwicklung messen lassen.
Der Kompaß der Theorie
Wer in einem internationalen System Sicherheit in jenem umfassenden Sinn erzeugen will, daß bei der Konfliktbearbeitung kein Staat zur Gewalt gegen einen anderen greift, muß zuerst die Ursachen klären, aus denen die Gewalt entsteht. Das Alltagsverständnis verortet sie in der Regel im bösen Nachbarn, der den Besten nicht im Frieden leben läßt. Diesen Nachbarn gibt es: Das Deutschland Adolf Hitlers und der Irak Sadam Husseins dokumentieren ihn, wenn auch mit deutlichen Unterschieden. Insgesamt gesehen stellt böse Absicht die Ausnahme dar.
Die Politikwissenschaft sieht eine ganz andere Ursache der Gewaltneigung, nämlich die anarchische Struktur des internationalen Systems. [6], Die große, in der angelsächsischen Welt vor allem verbreitete, aber eigentlich aus Europa stammende Schule des Realismus sieht in dieser Struktur sogar die einzige Gewaltursache. Weil das internationale System keine Zentralinstanz mit Sanktionskompetenz kennt, zwingt es seine Mitglieder, ihre eigene Sicherheit selbst zu gewährleisten. Das internationale System ist ein Selbsthilfesystem. Darin verhält sich jeder Staat gleich: Er bereitet sich auf den jederzeit möglichen Fall eines Angriffs durch Verteidigungsrüstung vor. Zwar weiß er, daß seine Verteidigungsmaßnahme vom Nachbarn als potentielle Angriffsvorbereitung gedeutet und mit eigener Aufrüstung beantwortet werden muß. Seine Strategie erzeugt also keine Sicherheit, ja gefährdet sie geradezu. Aber die Systemanarchie läßt dem Staat keine Alternative. Er muß sich auf einen Angriffsfall vorbereiten, einfach deswegen, weil er ihn nicht ausschließen kann. Im Aktions-Reaktions-Verhalten aller Staaten zueinander entsteht auf diese Weise ein Rüstungswettlauf, der in den meisten Fällen zum Krieg führt, also jenes Ereignis bewirkt, das eigentlich vermieden werden sollte.
Gewaltursache: Sicherheitsdilemma
Der Realismus akzeptiert dieses "Sicherheitsdilemma." [7], Er ist der Meinung, daß das es unabwendbar aus der anarchischen Struktur des internationalen Systems fließt. Man kann es bestenfalls eindämmen, indem man entweder implizit, durch den Aufbau von Gegenmacht, oder explizit, durch die Rüstungskontrolle, ein Gleichgewicht der Macht errichtet.
Dieser Ausweg ist nicht neu, hat eine lange Tradition [8], und leitete das Verhältnis beider Seiten im Ost-West-Konflikt an. Unausgesprochen liegt es der Beibehaltung und der Osterweiterung der NATO zugrunde. Beide nehmen eine mögliche Reaktion Rußlands in Gestalt neuer Aufrüstung in Kauf, weil sie dafür die Verteidigungsfähigkeit des Westens und einiger Staaten Mittelosteuropas zu gewährleisten vermögen. War die kontrollierende und die Aufrüstung einhegende Verständigung mit der Sowjetunion während des Kalten Krieges möglich, so wird sie unter den verbesserten Bedingungen der Gegenwart, unterstützt durch die "Grundakte" zwischen der NATO und Rußland, für noch wahrscheinlicher gehalten. Gegen die Ungewißheit über das zukünftige Verhalten Moskaus, aber auch gegen die zahlreichen, nicht benennbaren, aber eben auch nicht auszuschließenden Gefahren aus der außereuropäischen Welt [9], hilft nur die eigene Verteidigungsvorsorge.
Diese Denktradition ist beinahe enttäuschungsfest. Denn es ist evident, daß die Strategie des Machtgleichgewichts - ausgenommen den Kalten Krieg, wo der Gewaltverzicht zusätzlich durch die Nuklearwaffen erzwungen wurde - keinen Krieg verhindert hat. Die Politikkarte Europas sähe sonst anders aus. Hinzu kommt, daß das Gleichgewicht weder leicht zu definieren - es gibt mehr als 2000 Bedeutungen dieses Wortes - und noch schwerer konkret festzustellen ist. Die Schwierigkeiten, den Vertrag über die konventionelle Abrüstung in Europa den Bedingungen der Gegenwart anzupassen, geben ein beredtes Beispiel dafür ab.
Dabei gibt es durchaus eine Alternative zu dieser vermeintlichen "Realpolitik". Wenn die Anarchie des internationalen Systems nicht aufgehoben werden kann (es sei denn durch eine Integration), so kann sie doch abgemildert und geschwächt werden, wenn man die aus ihr fließende Ungewißheit reduziert. Schon das 18. Jahrhundert kam auf den Gedanken, die Staaten mittels einer Internationalen Organisation aus ihrer Isolierung zu lösen, zur kontinuierlichen Zusammenarbeit zu veranlassen und dadurch das notwendig Vertrauen über die Absichten der Nachbarn zu schaffen. Im Völkerbund wurde diese Idee zum ersten Mal, in den Vereinten Nationen dann dauerhaft verwirklicht. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Wien entstammt prinzipiell dem gleichen Denkansatz. Wenn die Staaten eines internationalen Systems in kontinuierlichem Arbeitskontakt miteinander stehen, verblaßt die Möglichkeit eines jederzeitigen Angriffs zu einer relativen Unwahrscheinlichkeit. Sie verschwindet nicht ganz, läßt sich aber abschätzen und entläßt die Staaten aus dem Sicherheitsdilemma. Je mehr sie kooperieren, desto stärker wächst das Vertrauen zwischen ihnen, desto geringer wird der Zwang zur Aufrüstung, desto marginaler das Sicherheitsdilemma. Nicht die Abschreckung der "balance of power" erzeugt Sicherheit, sondern die Zusammenarbeit in einer Internationalen Organisation.
Gewaltursache: Machtfigur
Der Realismus hat noch ein Derivat der Systemanarchie ausfindig gemacht, das ebenfalls als Gewaltursache wirkt: Die Machtverteilung. Entstanden aus den der Anarchie zu verdankenden Gewaltanwendungen, drückt die Machtfigur den jeweiligen Stand der Auseinandersetzung aus. Änderungen dieser Figur sind zumeist mit Gewaltanwendung verbunden. Die Gründung des deutschen Reiches 1871 hat die Landkarte des europäischen Systems so nachhaltig verändert, daß sie zur Mitursache zweier Weltkriege geworden ist. In der Teilung Deutschlands während des Kalten Krieges trat eine Spätfolge auf, die erst mit der Wiedervereinigung Deutschlands und dessen Integration in die NATO und die Europäische Union als beseitigt gelten kann.
Die Gründung des Staates Israel, um ein weiteres Beispiel zu nennen, hat vor 50 Jahren dazu geführt, daß der Nahe Osten bis heute nicht befriedet worden ist. Die Auseinandersetzungen auf dem Balkan lassen sich noch immer als Nachwirkung des Untergangs des osmanischen Reiches deuten. Machtfiguren also, das gilt es festzuhalten, sind als Gewaltursache nicht zu vernachlässigen.
Gewaltursache: Herrschaftssystem
Ist der Realismus damit am Ende seines Lateins, so hat die moderne Politikwissenschaft eine weitere, vermutlich sogar wichtigere Gewaltursache freigelegt: Das Herrschaftssystem der Staaten. Je autoritärer die Verfassung, desto größer die Gewaltneigung eines Staates. Vor allem gilt die Gleichung umgekehrt: Je demokratischer das Herrschaftssystem eines Staates, desto geringer seine Gewaltneigung. Die internationale Diskussion in der Politikwissenschaft, vor allem in den Vereinigten Staaten, hat mit großem Aufwand den empirischen Nachweis erbracht, daß Demokratien untereinander keine Kriege geführt haben. Die Beweislage ist hier so stabil, daß bereits von einem empirischen Gesetz gesprochen wird: Demokratien führen keinen Krieg gegen andere Demokratien. Sie bilden regelrechte Friedenszonen aus. Der sogenannte OECD-Friede beruht wie der in der Atlantischen Gemeinschaft und der in der Europäischen Union zuallererst auf der demokratischen Verfassung der Mitgliedstaaten. [10],
Die Dinge sind nicht ganz so einfach, wie sie hier dargestellt werden mußten. Aber der Zusammenhang zwischen dem Grad der Demokratisierung in einem Land, dem Grad der Freiheit und der Ablehnung der Gewaltanwendung ist logisch zwingend (darauf hat schon Immanuel Kant verwiesen), und er ist empirisch nachgewiesen. Die Verwandlung Westeuropas von einem Kriegsherd in eine Friedenszone ist der Demokratisierung der Herrschaftssysteme zu verdanken. Daß Deutschland von einem aggressiven Feind zum kooperativen Partner des Westens geworden ist, beruhte ausschließlich auf der nach 1948 einsetzenden Demokratisierung. Und war es nicht die "sanfte Revolution" in Osteuropa, die den Ost-West-Konflikt beendet und die Länder des Warschauer Paktes in Partner des Westens verwandelt hat?
Die Demokratisierung der Herrschaftssysteme ist die beste Therapie der Gewalt. Der Beweis wird nicht geschmälert durch die Tatsache, daß, statistisch gesehen, Demokratien im Verhältnis zu Nicht-Demokratien eine ungeminderte Gewaltbereitschaft an den Tag gelegt haben. Der Gewaltverzicht trat nur im Verhältnis zu Demokratien auf, nicht gegenüber autoritär verfaßten Staaten. Über die Ursachen dieses Phänomens wird in der Wissenschaft heftig gestritten; [11], sie sind jedoch für die Neuordnung Europas ohne Belang, weil es hier faktisch nur Demokratien - wenngleich unterschiedlichen Entwicklungsgrades - gibt. Wenn es gelingt, daß demokratische Herrschaftssystem in Europa zu stärken und zu festigen, wird eine der beiden wichtigen Gewaltursachen - in der Sicht der Liberalen Schule die entscheidende - beseitigt sein.
Der Entwicklungsbedarf zeigt sich nicht nur auf dem Gebiet des ehemaligen Warschauer Paktes, wenn er auch dort besonders deutlich zutage tritt. Auch die Demokratien in Westeuropa können noch nicht für sich in Anspruch nehmen, das telos der Demokratisierung erfüllt zu haben. Sie sind noch immer viel zu zentralistisch organisiert, haben gewissermaßen den streng hierarchischen Staatsaufbau der Monarchie beibehalten und lediglich die exekutive Spitze kollektiviert. Das gilt besonders für Frankreich und Großbritannien, gilt aber auch für die Bundesrepublik trotz ihres ausgebildeten föderalen Systems. Auch in Deutschland wird Macht noch immer zentral akkumuliert, statt dezentral distribuiert zu werden. Immerhin aber reicht der Grad der Demokratisierung in Westeuropa schon aus, um den ordnungspolitischen Bedarf des Gewaltverzichts zu decken. Ein Krieg zwischen den Staaten Westeuropas ist praktisch undenkbar geworden; eine neuerliche Gewaltanwendung gegen Osteuropa oder Rußland fände keine gesellschaftliche Akzeptanz.
Gewaltursache: Sonderinteressen
Zur Demokratisierung der Herrschaftssysteme und zur Bildung einer Internationalen Organisation, mit denen die beiden großen Gewaltursachen zurückgedämmt werden können, müssen noch zwei andere Strategien treten. Die eine kann hier nur erwähnt, die andere muß wenigstens skizziert werden. Der Prozeß der Demokratisierung beseitigt in seinem Verlauf eine Gewaltursache, auf deren Bedeutung James Mill schon anfangs des 19. Jahrhunderts hingewiesen hat: den Einfluß der Interessengruppen. Ihr privilegierter Zugang zu den Entscheidungszentren der Exekutive ist um so größer, je niedriger der Grad der demokratischen Kontrolle ist. Außenpolitik dient dann, in den Worten Mills "den Wenigen" und nicht "den Vielen." [12], Interessengruppen sind per definitionem kein Störfaktor im demokratischen Herrschaftssystem, sondern eine weitere Instanz der Vermittlung gesellschaftlicher Anforderungen in die Politischen Systeme. Hinzu kommt, daß in der postindustriellen Gesellschaft auch wirtschaftliche Interessen kaum noch nach dem Einsatz staatlicher Gewaltmittel rufen. Ihre Ziele bleiben meist unterhalb dieser Schwelle, bilden also nicht mehr, wie in der Hochzeit des Imperialismus, direkte Gewaltanlässe.
Indirekt tragen die Exportinteressen der Waffenindustrie durchaus zur Gewalt bei - ein Vorwurf, den UN-Generalsekretär Kofi Annan im Fall des Kosovo gegen die westliche Rüstungsindustrie erhoben hat. Wie groß ihr Anteil an dem Entschluß zur Osterweiterung der NATO gewesen ist, wird diskutiert, muß sich erst noch erweisen. Aber auch dort, wo der Gewaltbeitrag nicht einmal als Perspektive zu erkennen ist, müßte der Grad demokratischer Kontrolle gegenüber dem Einfluß der Interessengruppen erhöht werden. Es geht auf Dauer nicht an, daß Ölinteressen im Kaspischen Meer oder im Irak eine größere Bedeutung haben als die der Politik, daß das Tempo der Integration Osteuropas in die Europäische Union mehr von den Interessen des Agrobusiness Westeuropas als von den ordnungspolitischen Absichten der EU beeinflußt wird.
Gewaltursache: Gesellschaftliche Asymmetrie
Sehr viel gewichtiger als der ohnehin in Gang befindliche langsame Abbau des Millschen Syndroms präsentiert sich die Symmetrierung der gesellschaftlichen Potentiale als weitere Voraussetzung für den stabilen Gewaltverzicht in einem internationalen System. Diese Symmetrie ist keineswegs identisch mit der "balance of power" der vergangenen Staatenwelt, die sich aus dem Vergleich territorialer Größen, wirtschaftlicher Ressourcen und militärischer Gewaltpotentiale errechnete. [13], Dieses Konzept war, wie erwähnt, zu keiner Zeit funktional. Schon Kant hat seine Leistungsfähigkeit für den Frieden als "bloßes Hirngespinst" ridikülisiert. [14],
Unverkennbar ist aber, daß eine gewisse Symmetrie der gesellschaftlichen Potentiale in einem internationalen System einen weiteren Gewaltanlaß beiseite räumt. Auch darauf hat, wenn auch in veralteter Form, der Realismus aufmerksam gemacht. Er benannte, zu Recht, die Machtfigur als ein Derivat der Systemanarchie. Wenn sie durch Gewaltanwendung herbeigeführt worden ist und weiter aufrechterhalten wird, löst das Interesse an ihrer Korrektur weitere Gewaltanwendung aus. Zwar können grobe Asymmetrien außerordentlich stabil sein. Hegemonial figurierte Systeme, in denen eine Großmacht mehreren kleinen gegenübersteht, sind oft von beträchtlicher Dauer. Langfristig sind sie dennoch instabil, weil auch diejenigen Staaten, deren gesellschaftliche Potentiale nicht an das bei der Großmacht herrschende Niveau heranreichen, versuchen werden, diese Differenz auszugleichen. Eine Symmetrierung dieser gesellschaftlichen Potentiale ist daher ordnungspolitisch von großer Bedeutung. [15],
Dieser Ausdruck reflektiert auch den Wandel, den der Begriff der Macht im Übergang von der Vormoderne zur Postmoderne erfahren hat. Macht unter den Bedingungen des ausgehenden 20. Jahrhunderts hat sehr wenig mit den eben erwähnten Ressourcen und sehr viel zu tun mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, Innovationskapazität und Anpassungsgeschwindigkeit. Mit den alten Kategorien der Macht gemessen ist das Großherzogtum Luxemburg ein kleiner, die Schweiz ein großer Zwerg. Sieht man ihre gesellschaftlichen Potentiale an, rangieren sie an der Spitze Europas. Sie haben nicht den geringsten Anlaß zu Inferioritätskomplexen gegenüber ihren Nachbarn, deren Territorien größer und deren Gewaltmittel überlegen sind.
Die Entsprechung der gesellschaftlichen Potentiale in Westeuropa bildete eine stille, aber wichtige Voraussetzung für die Kooperation und Integration der EG. Die Figur dieser - modernen - Macht in Westeuropa ist egal. Um sie aufrechtzuerhalten, ist keinerlei Gewaltanwendung erforderlich; sie beruht, eben weil sie symmetrisch ist, auf dem Konsens aller.
Aus dem Umkehrschluß ergibt sich, daß asymmetrische Machtfiguren instabil sind. Warum sie entstanden sind und wer sie zu verantworten hat, ist weniger wichtig als der Angleichungsdruck, den sie auslösen. Gerade weil er sich nicht auf den nachholenden Zugewinn an traditionellen Gewaltmitteln, sondern darauf richtet, den in den Nachbarländern bereits erreichten Ausbau der gesellschaftlichen Potentiale nachzuvollziehen, ist seine Berücksichtigung nicht nur wichtig, sondern auch nützlich. Wirtschaftliche Wohlfahrt stellt die sozioökonomische Basis der Demokratie dar. Die Symmetrierung der gesellschaftlichen Potentiale beseitigt also nicht nur einen dem Korrekturinteresse entspringenden Gewaltanlaß; sie trägt auch direkt zur Demokratisierung der Herrschaftssysteme bei, die den Gewaltverzicht generell sicherstellt. [16],
Asymmetrische Machtfiguren präsentieren sich also unter den Bedingungen der Postmoderne nicht mehr als Verhältnis großer/starker zu kleinen/schwachen Staaten, sondern als ungleiche Verteilung gesellschaftlicher Potentiale. Die Russische Föderation, beispielsweise, ist nach den herkömmlichen Machtkatalogen der Bundesrepublik in jedem Bereich überlegen. Vergleicht man aber die gesellschaftlichen Potentiale, verhält es sich genau umgekehrt.
Dieser Befund sollte kurzfristig die Ängste beruhigen, die unterschwellig wiederbelebt werden. Er sollte analytisch darauf aufmerksam machen, daß auch die Sowjetunion nie so "mächtig" war, wie sie im Westen - und in Moskau - wahrgenommen wurde. Langfristig meldet der Befund aber einen Korrekturbedarf an: Es liegt im Interesse des Westens, diese Asymmetrie abzubauen und den Lebensstandard in der Russischen Föderation und in der Ukraine zu erhöhen. Nur dann egalisiert sich die Machtfigur im euro-atlantischen Bereich (der natürlich auch die anderen Mitglieder der GUS mit zu berücksichtigen verlangt).
Die richtige Strategie
Der von der Politikwissenschaft bereitgestellte Kompaß gibt also drei Orientierungen vor, denen der Aufbau einer stabilen, auf die Anwendung militärischer Gewalt auf Dauer verzichtenden europäischen Neuordnung folgen sollte. Erstens: Die Herrschaftssysteme aller Mitgliedstaaten müssen demokratisch strukturiert sein. Demokratisierungsstrategien sollten demnach an die Spitze der auswärtigen Politik der Mitglieder gerückt werden. Zweitens: Um die Anarchie des internationalen Systems zu mildern und den Zwängen des Sicherheitsdilemmas zu entgehen, muß die Kooperation der Systemglieder in einer internationalen Organisation eingerichtet werden. Das gilt auch für Teilsysteme. Drittens: Die gesellschaftlichen Potentiale sollten wenigstens einigermaßen symmetrisch sein. Die dazu erforderliche Entwicklungspolitik, die auch die sozioökonomische Basis des demokratischen Herrschaftssystems bereitzustellen hilft, muß als Sicherheitspolitik begriffen werden.
Teilsystem Europäische Union
Sieht man sich mit diesem Kompaß im euro-atlantischen System um, so findet man, daß zwei Teilsysteme, die Europäische Union und die Atlantische Gemeinschaft, viele der von der Theorie empfohlenen Ordnungselemente bereits aufweisen. Das Gegenteil gilt für das Teilsystem Rußland und GUS sowie für das euro-atlantische Gesamtsystem.
Die Herrschaftssysteme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union weisen einen relativ gleichmäßigen und relativ hohen Grad von Demokratisierung auf. Sie verdanken beides nicht zuletzt dem Marshall-Plan der Vereinigten Staaten. Sein Finanztransfer beflügelte den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg; die Einzelverträge mit den Empfängerstaaten banden die Hilfe auch an die Wiedererrichtung oder Errichtung eines demokratischen Herrschaftssystems. Als 1957 die Römischen Verträge für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft unterschrieben wurden, wiesen die Herrschaftssysteme der sechs Erstunterzeichner bereits einen beträchtlichen Grad von Demokratisierung auf. Er hat sich im Lauf der Jahre erhöht, wurde durch den Eintritt der meisten Mitglieder der Europäischen Freihandelszone verstärkt und färbte werbend auf neue Beitrittsaspiranten wie Portugal, Spanien und Griechenland ab. Auch die Demokratisierungsbestrebungen der zehn mittelosteuropäischen Staaten, die in die Europäische Union aufgenommen werden wollen, wurden durch diese Perspektive intensiviert (und in den Europa-Verträgen von Brüssel auch eingefordert). Ist die Demokratisierung deswegen noch nicht an ihr Ende gekommen und weist sie in den einzelnen Ländern erhebliche Unterschiede auf, so ist sie als Herrschaftsorganisation etabliert und kaum reversibel.
Fortschritt zur Integration
Bei der Reduzierung der Systemanarchie und der Vermeidung des Sicherheitsdilemmas hat Westeuropa einen qualitativ noch sehr viel größeren Schritt getan. Es hat in dem Vertrag von Maastricht die bisherige Kooperation im Rahmen einer Internationalen Organisation verlassen zugunsten von Teilintegrationen auf den Gebieten der Wirtschafts- und Währungs-, der Rechts- und Innenpolitik. Wenn am 1. Januar 1999 die Europäische Währungsunion in kraft tritt, haben deren Mitglieder ihre währungspolitische Teilsouveränität an die Europäische Zentralbank abgetreten. Die gesamtpolitischen Folgen dieses Schritts lassen sich noch nicht abschätzen. Sie bedeuten jedenfalls den Beginn einer neuen Ära in der Europäischen Union.
Die vorhergehende war ebenfalls durch die USA angeschoben worden, die als weitere Vorbedingung für die Marshall-Plan-Hilfe die Zusammenarbeit der Europäer in einer Internationalen Organisation, der OEEC, verlangt hatte. Mit der Montanunion, der Atomgemeinschaft und der Wirtschaftsgemeinschaft ging Westeuropa diesen Weg selbständig weiter, um dann, vorbereitet durch die einheitliche Europäische Akte von 1986 mit dem Vertrag von Maastricht die Wende in die Integration zu nehmen. Deren weitere Vertiefung ist seitdem das Hauptthema der Union, über das sie freilich auf der Konferenz von Amsterdam vergeblich beriet. Die Meinungsverschiedenheiten, die sich dort über die europäische "finalité politique" ergaben, die Verhinderung eines Alleingangs einer Kerngruppe, wie sie von dem sogenannten "Schäuble-Lamers-Papier" benannt worden war, müssen hier nicht weiter dargestellt werden. [17], Über die weitere Institutionalisierung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Aufnahme der Petersberg-Aufgaben der WEU in den Vertrag von Amsterdam wird später noch kurz zu reden sein.
Unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten ist bedeutend, daß in Maastricht der Weg der Europäischen Gemeinschaft in die Union beschlossen und in Amsterdam bekräftigt wurde, so daß die Beziehungen zwischen den Staaten der Europäischen Union ihren Charakter als zwischenstaatliche Beziehungen substantiell eingebüßt haben. Dementsprechend herrscht im System der Europäischen Union auch keine Anarchie mehr; die vom Realismus diagnostizierte erste Gewaltursache ist damit endgültig beseitigt. Wie immer die EU sich weiter entwickeln wird, ihre Binnenordnung wird nicht mehr durch Unübersichtlichkeit und Ungewißheit, sondern durch Verläßlichkeit und Vertrauen gekennzeichnet sein.
Tendenz zur Entdemokratisierung
Allerdings ist vor dem Trugschluß zu warnen, daß zusammen mit der Demokratisierung der Herrschaftssysteme die beiden großen Gewaltursachen innerhalb der Europäischen Union endgültig eliminiert worden sind. Eine davon könnte durchaus wiederkehren, allerdings nicht zwischen den Mitgliedern, sondern zwischen der Europäischen Union und ihrer Umwelt. Das wäre der Fall, wenn der Trend zur Entdemokratisierung, der sich im Prozeß der Integration deutlich bemerkbar macht, nicht revidiert wird. Im Souveränitätstransfer von den Einzelstaaten zur Union wird die demokratische Kontrollkomponente der nationalstaatlichen Parlamente - ein besonders wirksamer Bestandteil des demokratischen Herrschaftssystems - nicht an das Europäische Parlament weitergegeben, sondern von Kommission und Ministerrat sozusagen kassiert. Im Regionalstaat der Europäischen Union könnte die Demokratisierung auf einen geringeren Grad absinken als den, den die einzelstaatlichen Verfassungen aufgewiesen haben. Daraus könnten unerwünschte Folgen für das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und ihrer internationalen Umwelt entstehen.
Insofern muß hier ein Warnzeichen errichtet und darauf gedrungen werden, daß die Demokratisierung der drei unbestrittenen Konstruktionsmerkmale der sich vertiefenden Union: Dezentralisierung, Föderalisierung, Subsidiarität, hinzugefügt werden. [18], Der entstehende Regionalstaat darf nicht als vergrößerter Nationalstaat ausgebildet werden, obwohl der Vergleich mit den USA einen solchen Gedanken nahelegt. Nicht nur der globalen Machtfigur, auch den Interessen der EU-Bürger wäre damit nicht gedient. Sie versprechen sich von der Unionsbildung eine bessere Berücksichtigung bei der Wertverteilung. Hatte schon der Übergang vom europäischen Feudalstaat zum Nationalstaat einen solchen Fortschritt gebracht, so muß er sich im Übergang zum Regionalstaat potenzieren. Es gibt in der europäischen Theoriegeschichte, gerade auch bei Machiavelli und bei Montesquieu genügend Hinweise darauf, wie die Vergrößerung eines Staatsgebietes nicht der Konzentration, sondern der Diffusion von Macht dienen kann. Die Europäische Union muß zwar stark genug sein, um jeden Angriff von außen abzuwehren oder abzuschrecken, aber sie soll ihre Macht nicht nach außen wenden, sondern nach innen verteilen.. Sie soll eine Zivilmacht, kein Militärstaat sein.
Insofern klingen die Klagen über die Schwäche der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Union immer etwas verdächtig. Ebenso die Freude darüber, daß auf der Amsterdamer Konferenz die sogenannten Petersberg-Aufgaben der Westeuropäischen Union in den Artikel 17 des EU-Vertrages aufgenommen worden, die WEU näher an die WU herangerückt und die Perspektive deutlicher geworden ist, daß die Europäische Union "schließlich doch eine gemeinsame Verteidigungspolitik entwickeln wird." [19], Diese Perspektive muß bei der Betrachtung der Atlantischen Gemeinschaft noch einmal aufgegriffen und neu bewertet werden. Für das Funktionsverständnis der Europäischen Union ist sie nicht besonders vorrangig. Aufgabe des Regionalstaates ist die Pflege der Innenbeziehungen - entsprechend dem Toynbeeschen Diktum, daß der geschichtliche Fortschritt darin besteht, daß die Staaten sich von der Bekämpfung äußerer Feinde ab- und der Besserung ihrer inneren Zustände zuwenden. Eine Verteidigungsnotwendigkeit ist in absehbarer Zeit ohnehin nicht zu erwarten. Darüber hinaus steht für diese Zwecke die Militärallianz der NATO zur Verfügung.
Aufgaben der GASP
Die auf die Union wartenden sehr viel aktuelleren Aufgaben der gewaltfreien, aber konstruktiven Mitwirkung bei der Gestaltung der internationalen Umwelt könnte sie auch schon in ihrer jetzigen organisatorischen Ausstattung erbringen. Niemand hält die Mitglieder der Union davon ab, sich rechtzeitig und innovativ an der Bearbeitung der politischen Konflikte in der Welt zu beteiligen, vor allem ihnen vorzubeugen. Dafür ist nichts weiter erforderlich als der Entschluß.
Ihm muß allerdings die Einsicht vorangehen, daß die Konfliktprävention eine ganz andere Auffassung von Aktualität und Dringlichkeit voraussetzt als der Einsatz militärischer Gewalt, wenn der Konflikt schon ausgebrochen ist. Ihr politisches Schwergewicht, ihre gesammelte Erfahrung, ihre Wirtschaftskraft in ihrer internationalen Umwelt einzusetzen, um Bürgerkriege zu verhindern oder zu beenden und die Lebensbedingungen derart zu verbessern, daß Armutswanderungen und Flüchtlingsströme ausbleiben, ist der EU nicht verwehrt. In ihrer "Mittelmeerpolitik" hat sie sich einer solchen Aufgabe ja auch schon gewidmet. [20],
Die Bundesrepublik könnte ihre Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 1999 durchaus zum Anlaß nehmen, diese präventiven und kurativen Bestandteile der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in den Vordergrund der europäischen Aufmerksamkeit zu rücken. Vielleicht lassen sich damit auch die in Amsterdam erneut sichtbar gewordenen Blockaden der Weiterentwicklung der GASP überwinden. Die Konfliktprävention, wie sie UN-Generalsekretär Boutros-Ghali im Auftrag des Sicherheitsrats wenigstens andeutungsweise skizziert hat, ist in der westlichen Außenpolitik stark unterentwickelt. Eine Initiative hier bedeutet keine Konkurrenzen zur NATO, kollidiert auch nicht mit den Außenpolitiken der Mitgliedstaaten. Europa könnte auf diese Weise einen Beitrag für die westliche Politik leisten, der der GASP die gesuchte Identität verliehe.
Osterweiterung der EU
Der dritte Teil der Ordnungspolitik, die Symmetrierung der gesellschaftlichen Potentiale, fällt für die Europäische Union vorwiegend in ihrem Verhältnis zu ihren mittelosteuropäischen Beitrittsaspiranten an. Deren wirtschaftliche Rückstände bilden eines der größten Handicaps bei der ordnungspolitischen Hauptaufgabe der EU, alle osteuropäischen Länder vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer so schnell wie möglich zu integrieren. Sie müssen aus der Grauzone befreit werden, in der sie sich traditionell befanden und die sie seit der Auflösung des Warschauer Paktes wieder zurückgekehrt sind. Historisch, kulturell und ihrem eigenen Selbstverständnis nach sind diese Länder Teil Westeuropas. Daher ist die Europäische Union der ihnen zustehende politische Ort. Die Europäische Union hat sich allerdings mit der verbalen Synchronisation von "Vertiefung und Erweiterung" eine konzeptionelle Falle gestellt. Die beiden Prozesse lassen sich begrifflich kombinieren, sachlich enthalten sie eine contradictio in re. Ebenso wenig wie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, als sie 1957 gegründet wurde, zu einer Wirtschafts- und Währungsunion imstande gewesen wäre, sind die MOE in absehbarer Zeit in der Lage, der Wirtschafts- und Währungsunion der EU beizutreten. Vor allem dürfte es ihnen sehr schwerfallen, dem Wettbewerbsdruck in der Europäischen Union standzuhalten. [21], Es wäre besser gewesen, sich der Tatsache zu stellen, daß Europa faktisch sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegt und die MOE zusammen mit der Europäischen Union in einer Freihandelszone und einer Zollunion zusammenzuschließen. Sie wären dann mit der Union vereint, Europa zugehörig und ordnungspolitisch bereits dort lokalisiert. Sie hätten auf der anderen Seite die notwendige Zeit, ihre wirtschaftliche Entwicklung so voranzutreiben, daß sie entweder der Wirtschafts- und Währungsunion beitreten oder zu den Unionsmitgliedern aufschließen könnten, die der Währungsunion fernbleiben.
Einen schwachen Abglanz dieser ordnungspolitisch so wünschenswerten wie dringenden Maßnahme hätte das Startlinienmodell erbracht, für das die meisten MOE so sehr geworben haben. Die EU hätte, indem sie mit allen gleichzeitig die Beitrittsverhandlungen aufgenommen und sie erst später den Möglichkeiten entsprechend gestaffelt hätte, ihre Entschlossenheit und Bereitschaft bekundet, sie alle aufzunehmen. Statt dessen hat sie am 1. April 1998 neben den prospektiven NATO-Mitgliedern Polen, Ungarn und Tschechien nur Estland und Slowenien ausgewählt und die anderen in der Grauzone zurückgelassen. Durch diese ebenso unglückliche wie unnötige Politik wurde nicht nur das Baltikum gespalten. Es werden auch die erwünschten subregionalen Zusammenschlüsse wie die Zentraleuropäische Freihandelszone (CEFTA), die Visegradgruppe und die südosteuropäische Kooperationsinitiative (SECI) aufgebrochen. Polen muß als künftiges Grenzland der EU seinen bisher visafreien Verkehr mit der Ukraine einstellen, was auch deren Beitrittshoffnungen, die sich frühestens auf das Jahr 2010 richten, weiter zurückwirft.
Einer schnelleren und politisch besseren Politik der Europäischen Union stand hier keinerlei Führungskonkurrenz mit den USA oder Idealkonkurrenz mit der NATO und deren Osterweiterung im Wege. Es war ihre eigene Innovationsunfähigkeit, das verbohrte Festhalten an der Gleichzeitigkeit von Vertiefung und Erweiterung, die Unwilligkeit, Leistungen umzuverteilen oder Beiträge zu erhöhen, die, zusammen mit dem Pochen der Interessenten auf der Wahrung ihrer Besitzstände Brüssel in diese Aporie getrieben haben. Statt es allen MOE zu erlauben, ihre gesellschaftlichen Potentiale so schnell wie möglich zu entwickeln und sie dabei sofort in einen organisatorischen Zusammenhang mit der Europäischen Union zu bringen, hat sie sich auf einen selektiven Bilateralismus versteift, der "die wirtschaftliche Spaltung des östlichen Teiles Europas programmiert." [22], Eine Korrektur ist dringend angesagt.
Verhältnis zu Rußland und zur Ukraine
Nicht ganz so schwer wiegt, daß die Union zur Ukraine kein anderes Verhältnis gewählt hat als zu Rußland, nämlich einen Vertrag über Partnerschaft und Zusammenarbeit. Die Ukraine hätte gern einen Assoziierungsvertrag gehabt, weiß aber auch, daß sie bis zu ihm noch wichtige wirtschaftliche Schritte selbst zurücklegen muß. [23], Sie wird ihn bekommen, und langfristig sind ihre Beitrittschancen gut. Zwar ist die Ukraine das zweitgrößte Land Europas nach Rußland. Mit 50 Millionen Einwohnern gleicht ihr gesellschaftliches Potential dem eines mittleren europäischen Nationalstaats, befindet sich aber auf einem weit niedrigeren Entwicklungsniveau.
Auch Rußland fühlt sich von der Europäischen Union nicht optimal behandelt, vor allem weil das Abkommen für Partnerschaft und Zusammenarbeit vom Juli 1994 irgendwo zwischen einem normalen Handelsvertrag und den Europa-Verträgen angesiedelt und deswegen nicht als Übergang zu einer "wirklichen Partnerschaft" anzusehen ist. [24], Die Europäische Union ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Rußlands. Das Land nimmt den Rang 6 in der Liste der EU-Handelspartner ein. Seine Handelsbilanz ist durchweg positiv, wenngleich ihm die subventionierten Agrarexporte der EU zu schaffen machen. [25],
Auf der anderen Seite ist die Europäische Union richtig beraten, wenn sie den Gedanken an einen EU-Beitritt Rußlands gar nicht erst aufkommen läßt. Mit der Integration von weiteren 150 Millionen Menschen wäre die EU sichtlich überfordert, ihre Entscheidungsprozesse würden in der Überlast versinken. Aus dem gleichen Grunde wäre es nicht sinnvoll, die USA in die Europäische Union aufzunehmen.
Daß Rußland der Europäischen Union nicht beitreten kann, entbindet diese keineswegs von der Verpflichtung, auch dort für die Symmetrierung der gesellschaftlichen Potentiale als beste Voraussetzung für die Demokratisierung sowie für diese selbst zu sorgen. Die EU kann diesen Beitrag nicht allein erbringen; hier sind auch die USA gefordert (die durchaus antworten) und die internationalen Organisationen. Aber als "Zentralmacht Europas" [26], hat die Europäische Union natürlich eine ganz besondere Verantwortung für die Symmetrierung der gesellschaftlichen Potentiale in Rußland.
Unter dem Tacis-Programm der EU hat Rußland in der Zeit von 1991 bis 1996 927 Mio. Ecu erhalten [27], - das ist nicht gerade sehr viel. Auch ist die gesamte westliche Hilfe für Rußland und die anderen Staaten der früheren Sowjetunion seit der Mitte der neunziger Jahre drastisch zurückgegangen. Wandten alle OECD-Länder 1994 noch 22 Mrd. USD für diesen Bereich auf, so waren es 1995 nur noch 11 Mrd. Dollar. Das ist - will man einen Vergleich wagen - nur wenig mehr als die 13 Mrd. D-Mark, die die Bundesrepublik für die Sozialversicherung ihrer Landwirte 1995 aufgewendet hat.
Unter Hilfe darf nicht nur der finanzielle Aufwand verstanden werden, schon gar nicht bei einem Land wie Rußland, dessen Wirtschaft von außen kaum saniert werden kann. Vielmehr ist darunter auch Politikhilfe der verschiedensten Art zu verstehen; der Ministerrat der EU hat im Mai 1996 einen Aktionsplan für Rußland vorgelegt, der zu Recht den Akzent auf die Demokratisierungshilfe legt.
Auch mit ihrem (unkritischen) Beitrag zur Politik des gesamten Westens gegenüber Rußland beeinflußt die Europäische Union die Entwicklung des Herrschaftssystems dieses Landes. Die Gestaltung der internationalen Umwelt eines Staates ist von großem Einfluß auf dessen innenpolitische Entwicklung. Der Grad der Freiheit in einem Land, hat der britische Historiker Seeley Ende des vorigen Jahrhunderts festgestellt, ist umgekehrt proportional zum Außendruck auf seine Grenzen. Die Politik der EU-Staaten in dem Gürtel der osteuropäischen Staaten vom Baltikum bis zu Schwarzen Meer ist daher wie die gegenüber den außerrussischen Mitgliedern der früheren Sowjetunion von bedeutendem Einfluß auf die Entwicklung der herrschaftlichen Binnenstruktur in Rußland. Dieser Aspekt verdient viel mehr strategische Aufmerksamkeit als er bekommt.
Teilsystem: Atlantische Gemeinschaft
Die Atlantische Gemeinschaft stellt das zweite ordnungspolitische Element dar, das in Europa bereits existiert. Seine Bedeutung kann gar nicht überschätzt werden. Die enge Verbindung zwischen Nordamerika und Westeuropa, seit 1945 ständig gewachsen, ist zum Zentrum der westlichen Welt geworden. Sie beruht auf einer Wertegemeinschaft, reflektiert aber auch viele gemeinsame Interessen im Sachbereich der politischen Sicherheit und dem der wirtschaftlichen Wohlfahrt. Die Atlantische Gemeinschaft bildet einen Stabilitätsanker im euro-atlantischen System; sie exportiert aber auch Stabilität in die ganze Welt. So ist sie, neben und mit der Europäischen Union ein unentbehrlicher Baustein für jede Neuordnung Europas.
Die Stärken
Sie erfüllt alle drei Voraussetzungen für die dauerhafte Eliminierung der Gewalt im Binnenbereich. Die Herrschaftssysteme weisen eine demokratische Struktur auf, wiewohl mit einem Nachholbedarf. Da die Wahlbeteiligung bei Präsidentschaftswahlen in den USA ständig unter 50 % liegt, ist eine Hälfte der amerikanischen Bevölkerung politisch marginalisiert. Da es keine staatlich geordnete und von der Gesellschaft bereitgestellte Wahlkampffinanzierung gibt, erhalten die Interessengruppen, die die Wiederwahl der Kongreßmitglieder finanzieren, einen überproportionalen Einfluß. Für die gesamte Atlantische Gemeinschaft gilt, was bei der Europäischen Union schon festgestellt wurde: Sie haben im Prozeß der Demokratisierung eine bedeutende Wegstrecke hinter sich gebracht, aber noch eine große vor sich. [28],
In der Atlantischen Gemeinschaft sind auch die gesellschaftlichen Potentiale einigermaßen symmetrisch. Hüben wie drüben gibt es fast gleich viele Menschen: In Nordamerika sind es rund 300 Millionen, im Europa der Fünfzehn 372 Millionen. Ihr wirtschaftlicher Wohlstand liegt ebenfalls nicht weit auseinander, wenn auch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den USA mit rund 22.000 Dollar und Kanada mit 19.000 höher ist als im Durchschnitt der Europäischen Union, der sich bei 16.000 USD bewegt. [29],
Die Atlantische Gemeinschaft ist nach wie vor eine lockere Verbindung souveräner Nationalstaaten. Daß sie von der Systemanarchie so gut wie nicht betroffen wird und intern keinerlei Sicherheitsdilemma kennt, liegt an der Dichte und Dauer der Austauschbeziehungen, nicht zuletzt auf wirtschaftlichem Gebiet. Sie bildet einen Schwerpunkt der Investitionen und des Welthandels. Darüber hinaus gibt es eine vertragliche Verbindung zwischen Nordamerika und den meisten Staaten Westeuropas: die Militärallianz der NATO. Sie kann 1999 auf ein halbes Jahrhundert engster und erfolgreichster Zusammenarbeit zurückblicken. Im Entscheidungsapparat der NATO herrschen hohe Grade der Interaktion, die während des Kalten Krieges bis zur Integration gesteigert worden waren. Im Sachbereich der Sicherheit sind Nordamerika und Westeuropa also auf das Engste verknüpft: Zwischen Waffenbrüdern herrscht nicht nur Vertrauen, sondern Kooperation. Die NATO ist die Nabelschnur der Atlantischen Gemeinschaft.
Die Schwächen
Dieser Vorteil hat freilich auch zwei Nachteile. Erstens: Die organisierte Kooperation beschränkt sich auf den Sachbereich der Sicherheit. Es gibt in Politik und Wirtschaft kein Äquivalent für die NATO. Zweitens: In der NATO spiegelt sich die Symmetrie der gesellschaftlichen Potentiale nicht wieder, sondern die haushohe militärische Überlegenheit der Führungsmacht USA. Die NATO weist daher eine asymmetrische Binnenstruktur auf, die das Bündnis seit dem Anfang der sechziger Jahre belastet und damals zum Austritt Frankreichs aus der Militärorganisation geführt hat. Beide Schwächen haben sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts verstärkt bemerkbar gemacht.
Eine Entfremdung zwischen den politischen Eliten der USA und Kontinentaleuropas macht sich breit, die auch in der Bundesrepublik deutlich registriert wird. [30], Der Generationswechsel in der politischen Klasse verstärkt sie noch. In den USA wie in Europa gelangen Politiker in Führungspositionen, die die atlantische Solidarisierung des Kalten Krieges nicht mehr persönlich erfahren haben. In den USA nimmt daher die Rücksichtnahme auf die Empfindlichkeiten der europäischen Alliierten ab, in Europa der Widerstand gegen die amerikanische Bevormundung zu. Die Einführung des Euro wird diese Divergenzen noch verschärfen. Er wird, als Konkurrent des Dollar, die währungspolitische Handlungsfreiheit der Vereinigten Staaten erheblich einschränken und als Reservewährung mit dem Dollar gleichziehen. Hat sich die Europäische Union auf diese Weise als zweite Weltwirtschaftsmacht etabliert, wird sie auch den hegemonialen Anspruch der USA im Sachbereich der Sicherheit immer mehr abzuschwächen wünschen. In England, das zu den Vereinigten Staaten traditionell eine "special relationship" unterhält, wird diese Entwicklung sorgenvoll verzeichnet. [31],
Die USA stellen sich auf diese Veränderung der Machtfigur der Atlantischen Gemeinschaft ein und versuchen, ihr durch die Reform der NATO die Spitze zu nehmen. Der amerikanische Führungsanspruch soll durch die Modifikation erhalten bleiben. Präsident Clinton wollte 1994 noch weiter gehen und der Europäischen Gemeinschaft samt der WEU und der GASP eine größere Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit in Europa und damit auch ein größeres Stück der Gleichberechtigung mit den USA im Sachbereich der Sicherheit zugestehen. Seine Administration hatte, wie er auf der Gipfelkonferenz der NATO wörtlich sagte, "mit vorausgehenden amerikanischen Administrationen gebrochen." [32], Wurde diese Delle in der traditionellen amerikanischen Europapolitik alsbald wieder ausgeglichen, so blieb die Bereitschaft zur NATO-Reform. Sie wurde in Gestalt der Alliierten Streitkräftekommandos (Combined Joint Task Forces) verwirklicht. Freilich gelang es nicht, Frankreich, den Anwalt europäischer Gleichberechtigung in der NATO, restlos zu überzeugen. Paris trägt die Reform mit, kehrt aber nicht in die Militärorganisation zurück. [33], Die Machtverteilung in der NATO hat ihre moderne Figur noch nicht gefunden.
Die Tatsache, daß die Atlantische Gemeinschaft trotz des hohen Grades von Interdependenz im Sachbereich der wirtschaftlichen Wohlfahrt und in dem der politischen Sicherheit eine organisatorische Verbindung nur im Verteidigungsbereich aufweist, nimmt schon seit mehr als zwanzig Jahren wunder. [34], Sie behindert die außenpolitische Handlungsfreiheit der Atlantischen Gemeinschaft, die immer auf ein relativ hohes Maß militärischer Spannungen in ihrer internationalen Umwelt angewiesen bleibt. Würden sie abgesenkt werden, ließe sich die andauernde Existenz der NATO nicht mehr rechtfertigen. Damit wäre die einzige vertraglich organisierte Verbindung zwischen Nordamerika und Westeuropa geschwächt, die "Ankoppelung" der USA an Europa in Frage gestellt. Da daran niemand interessiert sein kann, erhält die Militärallianz einen strukturpolitischen Zusatzwert, der das Erscheinungsbild und die Entscheidungsprozesse der Atlantischen Gemeinschaft verzerrt. Wenn sie nur über die NATO politisch aktiv werden kann, engt sie ihre strategischen Möglichkeiten auf den Sektor ein, den das Militär ausfüllen kann. Der Reichtum der politischen und wirtschaftlichen Potenzen, der die Atlantische Gemeinschaft auszeichnet, bleibt unbenutzt.
Osterweiterung der NATO
So verengt sich der Beitrag der Atlantischen Gemeinschaft zur Neuordnung des euro-atlantischen Systems auf die Osterweiterung der NATO. Konnten deren Gründung des Nordatlantischen Kooperationsrates (der seit 1997 Euro-atlantischer Partnerschaftsrat heißt) ebenso wie das Kooperationsangebot der Partnerschaft für den Frieden als zutreffendes Leistungsangebot für 27 ehemalige Gegner des Warschauer Paktes gelten, so ist die Militärallianz zweifellos überfordert, soll sie als politischer Ordnungsfaktor wirken.
So wird sie indes eingesetzt. Die Osterweiterung der NATO versteht sich keineswegs als verteidigungspolitisches Komplement zur Erweiterung der Europäischen Union, sondern als eigenständiger und ausreichender Bestandteil der Neuordnung Europas. Zwischen EU und NATO gibt es erstaunlicherweise keinen Kontakt, geschweige denn Kooperation. Es herrscht eine stumme Konkurrenz. Präsident Clinton pries die Allianzerweiterung als "großen Meilenstein auf dem Weg zu einem ungeteilten, demokratischen und friedlichen Europa." [35],
In diese Aufgabenzuweisung mischten sich naturgemäß auch kleinere, taktische Interessen. Die USA signalisieren mit der Osterweiterung der Militärallianz ihre Entschlossenheit, "eine prinzipielle und zweckgerichtete amerikanische Rolle in Europa und der Welt aufrechtzuerhalten." [36], In der Bundesrepublik herrschte Freude darüber, daß die "Nachbarn im Osten fest in die Allianz eingegliedert, militärisch integriert und dem deutschen Bündnispartner direkt zugeordnet" (sic!) werden. [37],
Ordnungspolitisch wichtiger aber ist der Anspruch, die Neuordnung des euro-atlantischen Bereiches mit der Erweiterung einer Militärallianz erfolgreich und ausreichend betreiben zu können. Beschränkt sich die Erweiterung auf Polen, Tschechien und Ungarn, bleibt der größere Teil Osteuropas außen vor. Werden Rumänien, Bulgarien, Slowenien, die auf die zweite Aufnahmerunde hoffen, integriert, vielleicht sogar auch die Ukraine, bleiben noch immer die baltischen Staaten unberücksichtigt, obwohl sie besonders sehnlich beitreten wollen. Ebenso fehlen die meisten Balkanstaaten.
Vor allem aber bleibt Rußland ausgegrenzt. Will die NATO die Aufgabe, mit ihrer Erweiterung Europa "frei und ungeteilt" werden zu lassen, ernst nehmen, muß sie sich bis Wladiwostok hin ausweiten. Das ist die logische Folge des Anspruchs, nicht nur die Verteidigungsfähigkeit einiger weniger osteuropäischer Staaten zu erhöhen, sondern eben den Kontinent in Frieden und Freiheit neu zu gestalten. [38], Dann könnte die NATO freilich keine Verteidigungsallianz mehr bleiben, sondern müßte sich in eine Organisation kollektiver Sicherheit verwandeln, die sie nie war und auch kaum zu werden vorhat. Außerdem würde sie dann ihre Rückversicherungs- und Stabilitätsfunktion einbüßen, die ihre eigentliche Bedeutung ausmachen. Schließlich würde sie mit einer solchen Ausweitung nur die OSZE doubeln, die es ja schon gibt.
Die NATO hat sich ja seit 1991 in bedeutender Weise reformiert, hat mit der Partnerschaft für den Frieden die Kooperation mit Osteuropa und mit Rußland aufgenommen, sich in Bosnien der Aufgabe der UN-mandatierten Friedenssicherung gewidmet, unter Beteiligung Rußlands. Sie hat sich schon eine neue Organisationsstruktur verpaßt und wird im April 1999 ein neues strategisches Konzept vorlegen, das die veränderte Bedrohungslage reflektiert. Mit gewissem Recht konnte Generalsekretär Solana feststellen, daß die "NATO nicht nur eine Militärallianz, sondern eine politische Organisation wird." [39],
Eine Aufnahme Rußlands aber würde die NATO nicht reformieren, sondern revolutionieren. Schon die dann entstehende Größenordnung würde sie dysfunktional werden lassen, und zwar in noch höherem Maße als ein EU-Beitritt Rußlands, weil die Supermacht USA NATO-Mitglied ist. Auch strategisch machte die Aufnahme Rußlands keinen Sinn. Die USA verlören die NATO als Führungsinstrument ihrer Politik in Europa, die Osteuropäer die sie vor allem interessierende Schutzgarantie des Artikel 5.
Wird Rußland aber nicht aufgenommen, muß es zwangsläufig die NATO-Erweiterung als gegen sich gerichtet interpretieren. Die anarchische Situation des internationalen Systems läßt gar keine Alternative zu. Die zwischen Rußland und der NATO abgeschlossene Grundakte vom 27. Mai 1997 ist instrumentell viel zu schwach, um die Anarchie abzuschwächen. Wenn sich auch die Aufregung in Rußland gelegt und dem pragmatischen Versuch der Schadensbegrenzung Platz gemacht hat, so ist doch quer durch alle politischen Kraftfelder in Rußland ein gegen die NATO gerichteter Konsens festzustellen. [40], Er würde durch jeden Beitritt eines weiteren osteuropäischen Staates zugespitzt und verschärft werden. Damit steht das erklärte Ziel der westlichen Politik, Rußland nicht auszugrenzen, sondern einzubinden, "nicht gegen Rußland" [41], zu arbeiten, sondern mit ihm, in Frage. Ebenso wenig wie sich die Europäische Union gleichzeitig erweitern und vertiefen läßt, kann sich die NATO nach Osten ausdehnen und die partnerschaftliche Kooperation mit Rußland aufrechterhalten. Semantisch läßt sich der Widerspruch verbrämen, politisch ist er mit Händen zu greifen. Wird die Osterweiterung der NATO nach der ersten Welle nicht ausgesetzt, wie es in den USA und in Europa vorgeschlagen wird, [42], dann wirkt sie faktisch als Auftakt zu einer traditionellen "balance-of-power"-Politik, auf die Rußland, so rasch es geht, reagieren muß.
Fehlende Organisation
Das Dilemma wäre so nicht entstanden, hätte die Atlantische Gemeinschaft nicht nur eine militärische, sondern auch eine politische Organisation, durch die sie intern wie extern handeln könnte. So mußte die NATO den Beitrittswunsch der Osteuropäer sozusagen als Strohhalm ergreifen, um mit ihrer Weiterexistenz auch die der einzigen vertraglichen Bindung zwischen den USA und Westeuropa zu konsolidieren. Der hohe Grad der Interdependenz rechtfertigt seit langem eine umfassendere Gesamtorganisation. Sie wäre das geeignete Forum, das die Politik der Gemeinschaft im euro-atlantischen Bereich wie in der Welt allgemein besprechen und exekutieren könnte.
Diese Kooperation könnte auch die Krise in der Atlantischen Gemeinschaft auffangen und mit der Erzeugung eines neuen und modernen Konsenses abfangen. Bundeskanzler Kohl und Außenminister Kinkel haben anfangs der neunziger Jahre nicht umsonst den Gedanken an eine neue "Transatlantische Agenda" ins Spiel gebracht, an eine neue Ordnung der Atlantischen Gemeinschaft, die nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die politische Gleichberechtigung Europas reflektieren und zur neuen, dauerhaften Basis der Zusammenarbeit erheben würde. Dem Vorstoß war kein Erfolg beschieden. Was im Dezember 1995 in Madrid als "Neue Transatlantische Agenda" verabschiedet wurde, verbessert lediglich die Zusammenarbeit wirtschaftlicher Akteure über den Atlantik. Das ist nicht unwichtig, aber ordnungspolitisch unbedeutend.
Die Neuordnung der Atlantischen Gemeinschaft hat sich deswegen nicht erledigt. Gerade weil die Fortdauer der Gemeinschaft ebenso unentbehrlich wie dringlich ist, müßte sie ihre Organisationsform den jetzt schon erkennbaren Bedingungen der Zukunft anpassen. Jedermann spricht von den neuen Bedrohungen, die sich als Bürgerkriege, als Terrorismus, aber auch als wirtschaftliche Herausforderung und Konkurrenz präsentieren. In der außereuropäischen Welt vollzieht sich die Dritte Entkolonialisierung, die sich gegen die Dominanz westlicher Wert- und Ordnungsvorstellungen richtet und ihnen die eigene Tradition, die politische Kultur, sogar die Religion entgegenhält. Das Ende des Ost-West-Konflikts hat auch und gerade im euro-atlantischen Bereich den Begriff der Sicherheit verändert, weggeführt von der Verteidigungsnotwendigkeit und aufgefüllt durch die Notwendigkeit, gesellschaftliche Stabilität, Demokratisierung und wirtschaftliche Wohlfahrt zu erzeugen. Wenn die Atlantische Gemeinschaft nicht zerfallen, sondern sich als Akteur betätigen will, braucht sie eine politische Organisation. Sie könnte sich damit auch von den unnötigen Problemen befreien, die ihr dadurch entstehen, daß ihr als Instrumentarium für die atlantische Politik nur eine klassische Militärallianz zur Verfügung steht.
Als Vorstufe könnten die Europäer ihren Aufmerksamkeitsakzent von der Verteidigung auf die Politik verschieben. Es ist angesichts der anhaltend langen Ausprägung der amerikanischen Hegemonie in der NATO verständlich, daß deren europäische Mitglieder ihren Beitrag zu den gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen höher bewertet wissen wollen. Seit der NATO-Reform ist diese Europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität gewährleistet, wohl aber auch auf absehbare Zeit an ihre Grenze gelangt. Es ist unwahrscheinlich, daß die Vormacht USA, auf deren überragende Rüstung und Logistik die europäischen Mitglieder der NATO angewiesen bleiben werden, mit ihnen den Führungsanspruch teilt. Wollten sie mit den USA gleichziehen, würden nicht einmal 100 Mrd. USD reichen. [43], Es ist also weise, darauf zu verzichten und den Ruf nach einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsidentität (ESDI) etwas leiser zu stimmen. Die Europäische Union kann, wie erwähnt, auf absehbare Zeit ohne verteidigungspolitischen Arm existieren. Sie war gut beraten, auf der Konferenz von Amsterdam die WEU hauptsächlich mit den Petersberg-Aufgaben zu betrauen.
Was hingegen fehlt, ist eine politische Identität der Europäer, die gemeinsame Erarbeitung eines Selbstverständnisses ihrer politischen Rolle im euro-atlantischen System und in der Welt. Sie zu definieren, ist, wie der Versuch von Kopenhagen 1973 [44], zeigt, auch nicht leicht. Gelänge es aber, auf den neuen Feldern moderner Außenpolitik, der Gewaltprävention mit ihren unterschiedlichen Strategiefeldern, die politische Zusammenarbeit der Europäer zu verstärken, so würden sie nicht nur die Konfliktbearbeitung modernisieren. Sie würden die NATO aus der fatalen, von Generalsekretär Solana kürzlich wieder beklagten Lage befreien, erst handeln und das Konzept dazu später nachliefern zu müssen. Eine solche innovative Leistung würde auch von Washington anerkannt werden und der Europäischen Union auf dem wichtigen Gebiet der dem Militäreinsatz vorgelagerten Konfliktprävention ein Schwergewicht verleihen, das die in der NATO nun einmal inkorporierte Vormachtstellung der USA austariert. Europa hätte eine außenpolitische Identität.
Teilsystem: Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
Es ist nicht die Aufgabe des Westens, die Machtfigur zu bestimmen, die auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion errichtet werden soll. Er hat aber allerhöchstes Interesse daran, daß sie den Ordnungsprinzipien entspricht, auf denen die Europäische Union und die Atlantische Gemeinschaft beruhen. Deswegen muß hier ein Blick, wenn auch nur ein sehr kurzer, auf diesen Systemteil geworfen werden. Schließlich hat die Sowjetunion den Ost-West-Konflikt ausgelöst und vierzig Jahre lang intensiv geführt. Um so mehr muß der Westen darauf hinarbeiten, daß die wirtschaftlichen und politischen Strukturen der Nachfolger die Wiederholung ausschließen. Die Demokratie muß als Herrschaftssystem verfestigt und stabilisiert bzw. eingeführt werden. Der Lebensstandard muß soweit angehoben werden, daß die gegenwärtig vorherrschende Asymmetrie der gesellschaftlichen Potentiale abgebaut wird. Schließlich bedarf auch die GUS einer Organisationsform, die im Binnenverhältnis politische Stabilität dadurch erzeugt, daß sie die kleinen Mitglieder verläßlich vor dem großen schützt.
Diese drei Strukturen sind nicht leicht und vor allem nicht schnell einzurichten. Sie dürfen aber als handlungsanleitendes Ziel des Westens nicht aus dem Auge verloren werden. Nur wenn alle Mitglieder der GUS demokratisiert, einigermaßen wohlhabend und in einer Organisation zusammengeschlossen sein werden, ist die Renaissance der Gewalt im Außenverhältnis verläßlich ausgeschlossen. Gerade wer an der möglichen Gefährdung der osteuropäischen Staaten und der kleineren Nachfolger der Sowjetunion interessiert ist, muß die Erzeugung solcher Strukturen in der GUS zur obersten Richtschnur seines Handelns werden lassen. Werden diese Ziele erreicht, herrscht im euro-atlantischen Bereich jene Sicherheit, die die Herstellung von Verteidigungsfähigkeit (über das Normalmaß hinaus) hinfällig macht. Werden diese Ziele verfehlt, könnten gewaltsame Konflikte wiederkehren.
Der wichtigste Prozeß ist auch hier der der Demokratisierung. Gerade die Russische Föderation hat dabei schon beträchtliche Erfolge erzielt. Die Macht ist nicht mehr in Moskau zentralisiert, sondern in die Regionen ausgewandert. Föderalisierung ist bereits ein Faktum. [45], Die Demokratisierung der Föderation hat größere Fortschritte gemacht als die der Regionen.
Einmischungsstrategien
Um den Demokratisierungsprozeß im GUS - Bereich zu fördern, stehen dem Westen direkte und indirekte, mittelbar und unmittelbar wirkende Strategien zur Verfügung. [46], Zu den indirekten Strategien zählt die bereits erwähnte Gestaltung der internationalen Umwelt Rußlands; auch aus diesem Grunde empfiehlt sich, die NATO-Osterweiterung zu verlangsamen, jedenfalls bis sie durch eine Kontextänderung unmißverständlich geworden ist. Direkt und unmittelbar wirkt die Strategie der Konditionalität, die die Europäische Union sehr erfolgreich bei den osteuropäischen Staaten eingesetzt hat. Sie knüpft die Gewähr politisch-ökonomischer Vorteile an die Anhebung des demokratischen Niveaus. Indirekt wirkt die richtige Plazierung der Auslandsinvestitionen und eine gezielte Vergabe der Auslandshilfe, die die Gesellschaften stärkt und nicht die Politischen Systeme.
Dem Westen steht also eine große Palette von Strategien zur Verfügung, mit denen er den Demokratisierungsprozeß in Rußland und in den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion fördern kann. Die Erfolgsaussichten sind dabei in der Russischen Föderation und in der Ukraine am größten; dort sind sie auch am wichtigsten.
Die Europäische Union und die USA haben es an materialer Demokratisierungshilfe nicht fehlen lassen. Aber wenn man die Demokratisierung als die wichtigste Sicherheitsstrategie begreift, stand der dafür geleistete Aufwand immer schon in einem drastischen Mißverhältnis zu den finanziellen Aufwendungen, die die NATO-Staaten ihrer Verteidigungsrüstung zufließen ließen. Eine Umverteilung der Mittel ist fällig.
Sehr viel schwieriger wird es sein, die gesellschaftlichen Potentiale der früheren Sowjetunion auch nur einigermaßen auf ein Niveau zu bringen, das in Westeuropa und in den USA bereits erreicht worden ist. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf Portugals, einem der sogenannten ärmsten Länder der Europäischen Union, lag 1995 mit rund 9000 USD mehr als dreimal so hoch wie das in der Russischen Föderation. Die Ukraine wird von Portugal um mehr als das Zehnfache übertroffen. Die Russische Föderation besitzt zwar noch immer das größte Territorium der Welt. Ihr gesellschaftliches Potential aber ist mit 160 Millionen Bürgern sowohl der Zahl wie vor allem dem Wohlstand nach Westeuropa hoffnungslos unterlegen.
Diese Tatsache mag zunächst einmal diejenigen beruhigen, die Rußland vor allem als Erbe der Supermacht Sowjetunion ansehen - die sie, wie wir heute wissen, nur auf dem Rüstungssektor war. Diese Tatsache verdeutlicht aber vor allem die Größe der entwicklungspolitischen Aufgabe, die der Westen nicht aus den Augen verlieren darf. Die Erweiterung der Europäischen Union und der NATO hat Osteuropa derart in den Vordergrund der Aufmerksamkeit geschoben, daß der ordnungspolitische Elan in Warschau haltmacht. Er muß sich aber bis Wladiwostok erstrecken, soll das euro-atlantische System neu geordnet werden. Er muß sich auch auf die Politik der amerikanischen und europäischen Ölkonzerne richten, die bei der Erschließung der Ölvorkommen im Kaspischen Meer und bei der Streckenführung der Pipelines sich von sehr engen Interessen leiten lassen. Ob der von der Europäischen Union 1994 entworfene und 1997 in Kraft getretene "Vertrag der Energiecharta" ausreicht, um wenigstens gewisse Spielregeln allgemein verbindlich zu machen, [47], sollte aufmerksam beobachtet werden. Das Interesse am Gewinn nimmt, wie das an der Macht, nicht von selbst Rücksicht auf die Sicherheitsinteressen der Gesellschaft.
Schließlich muß der Westen auch entscheiden, ob er die GUS, also die Internationale Organisation der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, fördern oder bremsen will. Um sie ist es ohnehin nicht gut bestellt. Am ehesten dürfte noch die wirtschaftliche Zusammenarbeit überleben, zu der inzwischen auch Teilintegrationen wie der "Gemeinsame Wirtschaftsraum" oder die "Gemeinschaft integrierter Staaten", zu der sich Weißrußland, Kasachstan, Kirgistan und Rußland 1996 verbunden hatten, getreten sind.
Unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten würde es sich anbieten, den Zusammenhalt der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zu fördern, freilich unter der zuvor schon genannten Bedingung des Schutzes der kleineren Mitglieder vor dem großen. Tritt zu der schon deutlich ausgeprägten Föderalisierung Rußlands noch dessen Demokratisierung, so wäre die dann entstehende Machtfigur durchaus vergleichbar mit der, die die in der Entstehung begriffene Europäische Union eines fernen Tages aufweisen könnte. Die Prozesse laufen auf beiden Seiten umgekehrt, aber in der gleichen Richtung. In Westeuropa müssen kleine Einheiten zu funktionaler Zusammenarbeit bewogen; in Rußland muß ein leistungsunfähiger Großstaat in kleinere Einheiten und deren funktionale Zusammenarbeit zerlegt werden. Daß es ebenfalls Jahrzehnte dauern wird, bis sich die Organisationsstrukturen der um Osteuropa erweiterten EU und die der GUS einander ähneln, sollte niemanden schrecken. Hat der Ost-West-Konflikt praktisch 45 Jahre in Anspruch genommen, so müßte der Neuordnung des euro-atlantischen Raums der gleiche Zeitraum zugestanden werden. Sie bestünde dann aus der Europäischen Union (der alle osteuropäischen Staaten angehören werden), die zusammen mit Nordamerika die Atlantische Gemeinschaft bildet, und der GUS. Sie könnte mit der Europäischen Union in einer Freihandelszone verbunden sein, wie sie der Europäischen Kommission vorschwebt; sie würde mit der EU wie mit Nordamerika kooperative Beziehungen unterhalten.
Das euro-atlantische Gesamtsystem
Die Voraussetzungen für die Stabilität dieser Kooperation müßten, bis auf eine, in den Teilsystemen geschaffen werden, deren Herrschaftssysteme demokratisch zu strukturieren und deren gesellschaftliche Potentiale einigermaßen zu symmetrieren sein werden. Nur das dritte Element dieser Teilsysteme, die internationale Organisation, die die Systemanarchie beseitigt, müßte im euro-atlantischen Gesamtsystem eigens errichtet werden. Das ist relativ einfach, weil es die "Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" schon gibt. Sie wurde 1990 mit der Charta von Paris für ein neues Europa aus der seit 1975 so erfolgreichen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit [48], fortentwickelt und in Wien installiert. Ursprünglich zusammen mit der NATO, der Europäischen Union, der WEU und dem Europarat als gleichberechtigtes Instrument für die Neuordnung Europas aufgeführt, wurde sie alsbald in den Hintergrund geschoben und nur noch mit kleineren Detailaufgaben im Bereich der Friedenssicherung bedacht.
Zu dieser Fehlentwicklung haben nicht nur westliche Machtinteressen beigetragen, die durch russische Versuche, die OSZE für die Moskauer Politik zu instrumentalisieren, noch bestärkt wurden. Maßgebend ist die verbreitete Unkenntnis über das Leistungsvermögen einer Internationalen Organisation gewesen. Die OSZE wird, ähnlich wie die Vereinten Nationen, entweder als Regionalregierung mißverstanden und überfordert oder wegen des Fehlens jeglicher Gewaltmittel und der Kompetenz, sie einzusetzen, unterschätzt. Dabei liegt das Leistungsvermögen einer Internationalen Organisation ganz woanders: Sie kann die zweite große Gewaltursache, die Anarchie des internationalen Systems dadurch reduzieren, daß sie die Mitgliedstaaten aus ihrer Isolierung herauslöst, ihre Kooperation institutionalisiert und auf diese Weise wechselseitige Information und kollektives Vertrauen schafft. Sie könnte in dieser Funktion - um eine Metapher des früheren amerikanischen Senators Arthur Vandenberg aufzugreifen - mit einem "Rathaus" verglichen werden. [49], Indem die Parteien dort gemeinsam über ihr Zusammenleben beraten, lösen sie zwar nicht alle Probleme, schaffen aber wechselseitig Gewißheit darüber, daß sie bei der Konfliktbearbeitung ihre Existenz nicht in Frage stellen, also keine Gewalt anwenden werden. Die Internationale Organisation ist nichts weiter als eine dauerhafte Maßnahme der Vertrauensbildung über den Gewaltverzicht. Da sie damit die zweite große Gewaltursache - in den Augen des Realismus sogar die größte und einzige - aus der Welt schafft, kann diese Leistung gar nicht hoch genug veranschlagt werden.
OSZE als Organisation
Zunächst einmal müßte sie verstanden werden. Die OSZE sollte weder Moskau als trojanisches Pferd, noch dem Westen als Interventionsinstrument in der GUS, noch beiden zusammen als Hilfssheriff für solche Aufgaben dienen, die keine Seite der anderen überlassen will. Sie sollte aktiviert werden, damit im euro-atlantischen Raum die jedem internationalen System innewohnende Anarchie reduziert wird. Daß - und wie - sie wirkt, wurde bei der Erörterung der Osterweiterung der NATO und der russischen Reaktion darauf bereits gezeigt. Was die Union in Westeuropa, die NATO (intensiv, aber sehr eingeschränkt) in der Atlantischen Gemeinschaft erzeugten, was die GUS auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion eines Tages erzeugen sollte: Die stabile wechselseitige Erwartung des Gewaltverzichts kann für den euro-atlantischen Raum insgesamt durch die OSZE erzielt werden. Sie läßt seinen Charakter als internationales System unberührt, verändert aber dessen Binnenordnung. Weil die Systemanarchie reduziert worden ist, tritt kein Sicherheitsdilemma mehr auf. Die umfassende Sicherheit der Staaten ist gewährleistet. Das internationale System verändert seine Qualität; ein neuer Kontext der Außenpolitik ist entstanden.
Demokratisierung, Interdependenzen, Kommunikation haben dazu geführt, daß das euro-atlantische System nicht mehr als Staatenwelt, sondern nur noch als Gesellschaftswelt begriffen werden kann. Sie ist zwar noch immer staatlich partikularisiert, weist aber soviel wechselseitige Abhängigkeit auf, daß die Konsequenzen außenpolitischen Handelns auch von der eigenen Gesellschaft erlitten werden. Zwar trifft das schöne Wort Richard von Weizsäckers von der "Weltinnenpolitik" noch nicht einmal im euro-atlantischen Raum zu. Er bleibt, solange die Staaten bestehen, ein internationales System. Aber die gesellschaftlich-wirtschaftliche Interdependenz ist so groß geworden, daß die Atlantische Gemeinschaft schon die Strukturqualität eines Binnenraums besitzt. Die Gewaltanwendung untereinander ist, wie in der Europäischen Union, undenkbar geworden.
Multilaterale Kooperation als Strategie
Von diesem archimedischen Punkt aus zeigen sich die Umrisse einer modernen, den Bedingungen der Gesellschaftswelt angepaßten Außenpolitik. Sie müßte auch im euro-atlantischen Gesamtsystem sehr viel mehr Wert auf die Institutionalisierung multilateraler Kooperation setzen, wie sie die OSZE ermöglicht. Der NATO geschähe dadurch kein Abbruch. Sie ist als Stabilitätsfaktor und Rückversicherung unentbehrlich, auch als Versicherung gegen den "worst case", solange er nicht ausgeschlossen werden kann. Nur den ordnungspolitischen Anspruch, der ihr seit dem Herbst 1994 zugeschanzt wurde, verlöre sie.
Die Aktivierung der OSZE hätte über die Reduzierung der wichtigsten Gewaltursache hinaus auch noch kleinere, aber leichter sichtbare Folgen. Die multilaterale Zusammenarbeit zwischen den Staaten des euro-atlantischen Raumes verändert den Kontext jeder einzelstaatlichen Entscheidung. Würde der Kosovo-Konflikt in der OSZE verhandelt, die dazu die Suspendierung der jugoslawischen Mitgliedschaft beenden müßte, täten sich Serben und Kosovaren sehr viel schwerer als im traditionellen tête à tête mit westlichen Diplomaten. Wenn die GUS und die NATO-Staaten in Wien tagtäglich miteinander umgehen, entsteht ein Vertrauensverhältnis, dessen verhaltenspolitischer Wert unvergleichlich größer ist als der der Grundakte. Rußland könnte sich durch den ständigen und multilateralen Umgang mit den Politikern der NATO-Staaten ganz anders über deren Intentionen vergewissern als in dem Ständigen Gemeinsamen NATO-Rußland-Rat mit seiner Troika und deren periodisch-selektiven Begegnungen. In der OSZE ließe sich jener westlich-russische Kontext der Kooperation erzeugen, in dem die NATO-Osterweiterung auch in russischen Augen den Stellenwert erhielte, den sie in denen des Westens ehrlich hat. Die institutionalisierte Kooperation erzeugt die Übersichtlichkeit, die ein modernes internationales System so nahe an die Zustände der Innenpolitik heranrückt. Auch der Westen könnte bei intensiver Interaktion mit den Staaten der GUS ganz andere Aufschlüsse über deren innenpolitische Entwicklungen gewinnen, als im bilateralen Verkehr der Diplomaten.
Entscheidend bleibt: Die OSZE ist die beste und unter den modernen Bedingungen einzige Möglichkeit, mit der Systemanarchie eine der beiden großen Gewaltursachen zu beseitigen. Zusammen mit der Demokratisierung könnte sie das euro-atlantische System so verändern, daß es eine neue Ordnung erhält und die Wiederkehr der alten, von Militärallianzen, Machtgleichgewichten und Gewaltpotentialen gekennzeichneten Welt des europäischen Staatensystems gestoppt wird. Niemand hindert die Europäische Union, sich dieser Modernisierung des außenpolitischen Denkens anzunehmen und darin ihre politische Identität zu etablieren. Niemand hindert die Bundesrepublik daran, diesen Innovationsprozeß innerhalb der GASP anzustoßen.

© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition bb&ola | November 1998
