


International Politics and Society 2/1999
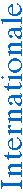
HANS-JOACHIM SPANGER
Der Euro und die transatlantischen Beziehungen - Eine geo-ökonomische Perspektive
Vorläufige Fassung / Preliminary version
Der Euro ist da und plötzlich wollen es alle gewußt haben. Da ist im Handelsblatt nach seinem "furiosen Start" von einer "Entfesselung der Finanzmärkte" ebenso die Rede wie von einem "Turbo für die Kapitalmärkte", der Japans "Ängste" verstärkt und dem US-Dollar "Konkurrenz" macht. Da läßt DIE ZEIT den amerikanischen Kolumnisten William Pfaff die "Großmacht Europa" beschwören, die mit ihrem "starken Euro" die Amerikaner zum "Zittern" bringt. Und DER SPIEGEL glaubt die Frage aufwerfen zu können, ob mit dem Euro bereits die Konturen einer "neuen friedlichen Weltmacht" sichtbar werden.
Offiziell jedoch überwiegt auch jenseits des Atlantik Gelassenheit: "Wenn der Euro für Europa arbeitet, dann wird er auch für uns arbeiten, weil wir an einem starken, blühenden Europa als Markt für unsere Produkte und als Partner in der Welt interessiert sind", so der Finanzstaatssekretär Lawrence Summers im Einklang mit seinem Präsidenten. Mehr noch scheint manchem Beobachter zumal ökonomischer Provenienz der Euro einer weiteren "Amerikanisierung" Europas den Weg zu bereiten, weist diesen gleichsam als nachholende Modernisierung der europäischen Kapital- und Gütermärkte unter dem Diktat der Globalisierung aus. Daß der Euro neue wirtschaftliche Horizonte eröffne, von denen mit Europa nolens volens auch die USA profitieren werden, ist indes nur eine Sicht der Dinge. Für sie ist der gemeinsame Nutzen wirtschaftlichen Wettbewerbs im Sinne absoluter Vorteile der entscheidende Maßstab.
Die geo-ökonomische Antithese zum neoliberalen Globalisierungsparadigma
Ganz anders urteilt William Pfaff: "In einer globalisierten und deregulierten internationalen Wirtschaft prallen die unvereinbaren Interessen beider Seiten unvermittelt aufeinander." Hier wird der Wettbewerb vor allem an den individuellen Positionsgewinnen nach Maßgabe relativer Vorteile gemessen.
Nun stellt es eine conditio sine qua non marktwirtschaftlicher Ordnungen dar, daß wirtschaftlicher Wettbewerb zwar durchaus den Wohlstand zu mehren vermag, zugleich aber national wie international Gewinner und Verlierer hervorbringt und daher in hohem Maße konfliktträchtig ist. Welche Konsequenzen daraus zu ziehen und wie diese Konflikte ordnungspolitisch zu steuern sind, wird höchst kontrovers diskutiert. Unter den Schlagworten der "Globalisierung" und der "Geoökonomie" halten hier Theorie und Wirklichkeit der neunziger Jahre aus unterschiedlicher Perspektive ebenso unterschiedliche Rezepturen bereit - mit dem gemeinsamen, durch den Euro aktualisierten Anspruch, nicht nur die Realität adäquat erfassen, sondern auch politisch bewältigen zu können.
Geoökonomie und Globalisierung stellen zwei Seiten einer Medaille dar - der (vermeintlichen) Ökonomisierung der internationalen Beziehungen. Diese These bildet gleichsam den Kern der in liberaler Tradition argumentierenden Theorien, die schon seit geraumer Zeit mit der Intensivierung transnationaler Beziehungen, der wachsenden internationalen Arbeitsteilung und im Zeichen ökonomischer Interdependenz eine "Zivilisierung" der Staaten und eine Transformation des internationalen Systems konstatieren.
Prinzipiell sind mit dieser Akzentverlagerung ideale Voraussetzungen für die Allianz aus liberaler politischer Theorie und jenen Ökonomen gegeben, die in neoklassischer Tradition Wohlstand für das einzige rationale Staatsziel und offene Regime des wirtschaftlichen Wettbewerbs für sein logisches Äquivalent halten. Danach ist es, um ein der Bush-Administration zugeschriebenes Bonmot aufzugreifen, gleichgültig, ob in einem Land "potato chips" oder "computer-chips" hergestellt werden. Entscheidend ist, daß beides nach Maßgabe der komparativen Vorteile produziert und frei getauscht werden kann, um so den gemeinsamen Nutzen zu maximieren. Der Staat taucht hier nur als intervenierende, sprich: störende Variable auf. Angetrieben von den für ihn charakteristischen relativen Vorteilskalkülen - camouflierend: "ökonomischen Interessen" -, beschränkt er mit seinen darauf fußenden protektionistischen Anwandlungen und industriepolitisch generierten Fehlallokationen in der Realität nur allzu wirkungsvoll die freie Entfaltung der Produktivkräfte und damit den gemeinsamen Wohlstandsgewinn. Das Ergebnis: Alle wollen wegen der höheren Wertschöpfung Computer-Chips herstellen.
Die "Globalisierung" verspricht nun, die Diskrepanz zwischen (neoklassischer) ökonomischer Theorie und (merkantilistischer) politischer Praxis gleichsam objektiv zugunsten des Marktes aufzuheben. Zum einen reflektiert sie analytisch reale Veränderungen im Fortgang jener Prozesse, die früher als "Internationalisierung" auf den Begriff gebracht wurden. Zum anderen signalisiert die Globalisierung konzeptionell wie programmatisch "neue Rahmenbedingungen für die Zukunft von Staat und Politik". Mit ihr scheint eine Welt auf, die auf längere Sicht gänzlich auf den Staat als internationalem Akteur verzichten zu können meint und ihn aktuell in seiner Handlungsfähigkeit aushöhlt. Positiv gewendet zeichnet sich im Sinne des Liberalismus und des neoklassischen Paradigmas eine schöne neue Welt multilateraler Arrangements ab, dank der ökonomisch, durch die grenzüberschreitenden Güter- und Kapitalmärkte diktierten Notwendigkeit internationaler Kooperation. Negativ gewendet läßt die Impotenz des Staates im Sinne der klassischen Kapitalismus-Kritik hingegen eine Welt wachsender Ungleichheit, sozialer Fragmentierung und à la longue auch neuer (Bürger-)Kriege entstehen.
Daß die Quantität globaler ökonomischer Verflechtung nicht zwangsläufig eine neue Qualität staatlichen Handelns begründet, dokumentiert die realistische Konkurrenz des Globalisierungsparadigmas. Aus deren Perspektive ist es verfrüht und mehr noch systematisch ausgeschlossen, mit der Ökonomisierung der internationalen Beziehungen deren tragenden Akteur, den Staat, abzuschreiben. Vielmehr habe sich lediglich eine neue Arena staatlicher Konkurrenz aufgetan. Auch hier steht ein populärer Begriff bereit: "Geoökonomie", ein Neologismus, der 1990 Edward Luttwak am besten geeignet schien, um die neue Komposition aus "der Logik des Konflikts und den Methoden des Handels" zu erfassen. Jenseits des Ost-West-Konflikts suchen die Staaten einen "geoökonomischen Ersatz für ihre verkümmernde geopolitische Rolle". Sie seien nicht länger bereit, den ökonomischen Wettbewerb, den die "Logik des Handels" diktiert, der politischen Allianz, im Kalten Krieg aus der "Logik des Konflikts" mit einem gemeinsamen Feind entstanden, unterzuordnen. Vielmehr verschmelzen im Zeichen der Geoökonomie wirtschaftlicher Wettbewerb und politischer Konflikt.
Die Geoökonomie ist die Antithese zur neoklassischen internationalen Ökonomie auch in ihrem aktuellen Gewand, der Globalisierung. So gilt deren Betonung der absoluten Vorteile etwa Samuel Huntington bestenfalls als naive deformation professionelle der ökonomischen Zunft. Da die Ökonomie beides zugleich ist, Grundlage der Macht und Instrument der Machtausübung, und da Macht immer relativ ist, es im ökonomischen Wettbewerb daher allein auf die relativen Vorteile ankommt, gilt (nicht nur) für Huntington: "Economics is the continuation of war by other means." Die Geoökonomie ist folglich wenig mehr als alter (sicherheitspolitischer) Wein in neuen (ökonomischen) Schläuchen. Jenseits des Kalten Krieges beschwört sie ein neues, durch den auf die Staaten projizierten ökonomischen (Vernichtungs-) Wettbewerb angetriebenes Konfliktmuster, das deutlich mit dem kooperativen Imperativ der Globalisierung kontrastiert. Der Euro, soviel wurde schon im statu nascendi deutlich, weckt beide Assoziationen.
Das internationale Gewicht der Europäischen Währungsunion
Wie immer die Perspektiven des Euro bewertet werden, in einem Punkt sind sich die meisten Beobachter schon seit geraumer Zeit einig: Er stellt eine "Wasserscheide" dar, für Europa wie für das internationale Währungssystem, wirtschaftlich wie auch politisch. Ob der gemeinsame europäische Währungsraum eine ausreichende monetäre, fiskalische und realwirtschaftliche Konvergenz und damit auch eine nachhaltige Kohärenz aufweist, ist Gegenstand hitziger Debatten. Und ob vor dem Hintergrund vergleichbarer Disparitäten im nationalen Maßstab seiner Mitgliedsländer eine zentralisierte Geldpolitik mit einer dezentral-souveränen Steuer- und Haushaltspolitik kombiniert werden kann, muß mangels einschlägiger Vorbilder für einen solchen heterodoxen Ansatz nolens volens offen bleiben.
Unstrittig ist lediglich, daß von der Währungsunion ein erheblicher steuerpolitischer Harmonisierungsdruck und über den "Stabilitätspakt" hinaus ein nicht minder gewichtiger wirtschaftspolitischer Koordinierungsbedarf ausgeht. Insofern werden die bestehenden Grenzen nachhaltig transzendiert, ist der Euro ein hochgradig politisches Projekt. Sein Erfolg entscheidet nicht nur über das künftige, zunehmend föderale Gesicht der Union, sondern auch darüber, ob diese in die Lage versetzt wird, wenn schon nicht in der Außen- und Sicherheitspolitik, so doch in der Weltwirtschaft als eigenständiger Akteur mit ordnungspolitischem Gewicht aufzutreten.
Angesichts seiner lange Zeit vagen Realisierungsperspektiven, kann es nicht verwundern, daß erst jüngst die äußeren Implikationen des Euro ins Visier genommen wurden. Dabei läßt bloße Arithmetik erkennen, daß in Sonderheit die transatlantischen Beziehungen einer Bewährungs- und Belastungsprobe unterzogen werden, denn zum einen stellt der Euro eine Herausforderung für den US-Dollar als Weltreserve- und Transaktionswährung dar, und zum anderen konstituiert er gleichsam einen Wirtschafts- und Währungsraum "in its own right".
Bis heute konzentrieren sich 60% der globalen Wirtschaftsleistung in der nördlichen Hemisphäre. Allerdings verteilen sich diese gleichmäßiger als in der Vergangenheit auf die drei Pole USA, Japan und Europäische Union bzw. die elf Mitgliedsländer Währungsunion. So entfielen 1996 auf die USA 20,7%, auf die Europäische Union 20,4% und auf Japan 8% des globalen Sozialprodukts. Ähnlich verhielt es sich 1996 mit 15,8% für die USA, 20,2% für die EU und 10,4% fürJapan bei den Anteilen am Weltexport. Schließlich bleibt festzuhalten, daß auch die einst beträchtlichen Unterschiede in der Produktivität zwischen den USA, Europa und Japan in den neunziger Jahren eher geringer geworden sind und daß diese sich heute grosso modo auf "der gleichen technologischen Ebene" bewegen.
In einem Bereich allerdings verfügen die USA nach wie vor über eine herausragende Position: Der US-Dollar ist auch heute noch die unangefochtene Leitwährung. Mit 48% wird nahezu die Hälfte des Welthandels und wurde bis zur Einführung des Euro selbst ein Drittel des intra-europäischen Handels in US-Dollar fakturiert, während die Währungen der 15 EU-Staaten auf zusammen 31% und der Yen auf lediglich 5% kommen. Noch größer ist der Unterschied bei den globalen Währungsreserven, von denen Ende 1995 56,4% auf den US-Dollar, 25,8% auf die EU-Währungen und 7,1% auf den Yen entfielen. Mithin ist das Gewicht des US-Dollar auf den internationalen Märkten mehr als doppelt so groß wie der Beitrag der amerikanischen Volkswirtschaft zum Weltsozialprodukt und Welthandel. Damit korrespondiert, daß 1997 bei 8.559 börsennotierten Unternehmen die Marktkapitalisierung in den USA mit 10,9 Billionen US-Dollar mehrfach höher lag als in der Euro-Zone mit 2.769 Unternehmen und 2,7 Billionen US-Dollar und Japan mit 2.334 Unternehmen, die auf sich 2,1 Billionen US-Dollar vereinen was allerdings, wie nicht zuletzt das japanische Beispiel illustriert, eine Größe mit hoher spekulativer Varianz darstellt. Bei den Rentenmärkten wiederum erreicht das Volumen der Euro-Zone 50% des US-Dollar und 130% der Yen-Anleihen.
Dieses Muster der globalen Kräfteverteilung, auf das vor allem sich der ungebrochene amerikanische Führungsanspruch gründet, hat sich in den vergangenen 25 Jahren seit dem Zusammenbruch der Währungsordnung von Bretton Woods nicht grundlegend verändert. Auch die dramatisch aufscheinende japanische Herausforderung erwies sich als transitorisches Phänomen der achtziger Jahre, das mit der Spekulationsblase platzte und heute lediglich noch als Risiko für die Weltkonjunktur Beunruhigung auslöst. Jenseits des damaligen Alarmismus waren die Chancen Japans, die USA zu überflügeln, auf Grund der quantitativen Relationen ohnedies ähnlich gering wie seine Aussichten, durch Arrondierung seines ostasiatischen Einflußbereichs das eigene Gewicht zu erhöhen. Anders verhält es sich dagegen bei der Europäischen Währungsunion, denn von hier kommt in der Tat die potentiell gavierendste Herausforderung für die künftige Suprematie der USA: Mit dem Euro erwächst dem Dollar erstmals seit siebzig Jahren ein ernsthafter Konkurrent - und dies in einer nachgerade klassischen Nullsummen-Konstellation, denn was der Euro gewinnt, verliert der Dollar.
Von der unilateralen zur bipolaren Weltwährungsordnung
Der Euro vollendet einen Binnenmarkt amerikanischer Größenordnung, und er konstituiert einen integrierten Geld- und Kapitalmarkt, der zwar einstweilen nicht an die US-Dimensionen heranreicht, wohl aber nach Überwindung der nationalen Fragmentierung ähnlich breit und liquide ist. Beides stärkt im Unterschied zu den einstigen nationalen Währungen der Union und weit über deren Grenzen hinaus den Euro als Zahlungsmittel, Recheneinheit und Vermögenstitel. Die Transaktionskosten auf den europäischen Güter- und Kapitalmärkten sinken, die Attraktivität des Euro als Handels- und Anlagewährung steigt.
Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Da mit dem Euro eine internationale Währung entsteht, die weit mehr darstellt als die Summe ihrer Teile, werden sowohl die Zentralbanken als auch die privaten Investoren ihre Anlagen zugunsten der europäischen Währung und damit auf Kosten des US-Dollar diversifizieren. Daß es zu Verlagerungen kommen wird, ist weithin unstrittig. Offen sind lediglich der Umfang und - was nicht minder wichtig ist - der Zeitfaktor. Beides hängt nicht zuletzt von den Erwartungen an die Stabilität der neuen Währung und damit vom Zusammenspiel der gemeinsamen Geld- und der nationalen Fiskalpolitik in der Euro-Zone ab.
Das betrifft zum einen die Diversifizierung der offiziellen Währungsreserven, im Umfang von Ende 1996 weltweit mehr als 1 Billion US-Dollar. Im gleichen Maße wie der Euro als Anker- und Transaktionswährung genutzt wird, sind hier Umschichtungen zu erwarten und durch eine Reihe von Zentralbanken bereits auch annonciert. Hinzu kommt, daß nach der Umstellung das System der Europäischen Zentralbanken mit etwa 200 Milliarden US-Dollar über Währungsreserven verfügt, die nicht nur die amerikanischen und japanischen, sondern auch die herkömmliche Relation zum Importvolumen deutlich übersteigen und sich zu 90 Prozent aus US-Dollar zusammensetzen. Dies allein könnte Anlaß sein, in einem überschaubaren Zeitraum Anlagen im geschätzten Volumen von 50 bis 100 Milliarden US-Dollar abzugeben.
Da das Gesamtvolumen der offiziellen Währungsreserven jedoch auf den internationalen Devisenmärkten an einem einzigen Tag umgesetzt wird, dürfte von etwaigen privaten Portfolioumschichtungen eine noch ungleich höhere Hebelwirkung ausgehen. Hier bewegen sich Schätzungen in der Größenordnung von 400 bis 800 Milliarden US-Dollar zu Gunsten des Euro. Auch wenn überwiegend eine nur graduelle Verlagerung erwartet wird, sicher ist dies zumal bei den privaten Investitionen keineswegs. Die Asien-Krise mit ihren über Japan vermittelten Kettenreaktionen oder die wachsende Verunsicherung über Spekulationsblasen in den USA schaffen vielmehr ein aktuelles Umfeld, das auch sehr kurzfristige Reaktionen möglich macht.
Portfolio-Verlagerungen in der genannten Größenordnung würden den US-Dollar unter einen erheblichen Ab- und den Euro unter Aufwertungsdruck setzen. Es war offenkundig diese Gefahr, die den deutschen und den französischen Finanzminister veranlaßten, in einem gemeinsamen Memorandum Anfang 1999 die US-Administration öffentlich zu einer engen währungspolitischen Kooperation aufzufordern. Auch wenn die befürchtete Volatilität im Euro-Dollar-Verhältnis lediglich ein Übergangsphänomen darstellen sollte, so wirft allein dies in den nächsten Jahren beträchtliche Steuerungsprobleme auf. Wichtiger aber noch sind die langfristigen Wirkungen des Euro.
Wenn es zutrifft, daß der Euro früher oder später als zweite Leitwährung zum Dollar aufschließt, dann beschneidet dies jene Privilegien, die die USA als Hüter der de-facto-Weltreservewährung gegenwärtig noch genießen. Das betrifft zum einen das Privileg der Seignorage durch die nahezu kostenlose Ausgabe einer weltweit akzeptierten Währung. Zum anderen betrifft es die Kosten der Staatsverschuldung, die dank der Liquidität des US-Rentenmarktes geringer ausfallen. Schätzungen zufolge ergeben sich aus beidem für die USA jährliche Einsparungen in der Größenordnung von jeweils 5 bis 10 Milliarden US-Dollar. Nicht zuletzt aber betrifft es die nahezu unbeschränkte Fähigkeit zur Schuldenaufnahme in der eigenen Währung, weitgehend immun gegen deren Schwankungen. General de Gaulle hat dies einst als singulär amerikanisches Privileg gegeißelt, sich "kostenlos" bei anderen Staaten verschulden zu können. Wie essentiell dieses Privileg ist und wie schmerzhaft es sein dürfte, hier an Grenzen zu stoßen, dokumentiert der ungebrochen hohe Bedarf zur Finanzierung des US-Leistungsbilanzdefizits, das - heute auf skurrile Weise als Ausweis der ebenso ungebrochenen Stärke der US-Wirtschaft interpretiert - im Unterschied zum Haushaltsdefizit keinerlei Anzeichen einer Trendumkehr erkennen läßt und 1999 in die präzedenzlose Dimension von 300 Milliarden US-Dollar und damit 4% des BIP vorstoßen könnte. Daß dem auf der anderen Seite ein europäischer Leistungsbilanzüberschuß in der Größenordnung von mehr als 100 Milliarden US-Dollar gegenübersteht, läßt für eine Verstetigung der Relation beider Währungen ebenfalls nichts Gutes erwarten.
Was die Vereinigten Staaten hier an Handlungsfreiheit tendenziell einbüßen werden, gewinnt auf der anderen Seite die Europäische Währungsunion. Mit einer Außenhandelsquote von wenig mehr als 10% des BIP und einem wechselseitigen Außenhandelsanteil von kaum 20% - ist sie ähnlich wie die USA und Japan und anders als zuvor ihre einzelnen Mitglieder relativ immun gegen externe Schocks. Auch ist es nicht länger möglich, einen Keil zwischen die nationalen europäischen Währungen zu treiben. Eine Politik des "benign neglect" gegenüber dem US-Dollar, mit der die USA in der Vergangenheit die Europäer mehrfach unter Druck gesetzt haben und ihre Ziele durchzusetzen verstanden, ist künftig zwar nicht ausgeschlossen, doch ändert sich grundlegend die Kosten-Nutzen-Kalkulation. Umgekehrt ist es nicht zufällig, daß der deutsche und der französische Finanzminister in ihrem Memorandum vor einer wechselseitigen Politik des "benign neglect" warnen, was unter den veränderten Prämissen nunmehr zumindest auch eine europäische Option darstellt.
Mit dem Euro wandelt sich die bestehende unipolare in eine nicht minder ungeordnete bipolare Weltwährungsordnung. Prinzipiell erfordern sowohl die kurzfristigen Steuerungsprobleme im Übergang als auch die längerfristigen, mit der Kräfteverschiebung verbundenen Probleme eine enge euro-atlantische Koordination. Das sollte in einer relativ symmetrischen bilateralen Konstellation leichter möglich sein als in einer zu wechselnden Koalitionen einladenden trilateralen oder einer asymmetrisch-unübersichtlichen multilateralen. Es verlangt allerdings auf amerikanischer Seite, Abschied zu nehmen von der unipolaren Illusion der einzig verbliebenen Supermacht, und auf europäischer Seite erfordert es globale Handlungsfähigkeit. Für beides stehen die Chancen nicht eben gut.
Auch wenn in den USA im Unterschied zum eigenen Land an Europa gegenwärtig nur die "sklerotischen" Erscheinungen einer hohen Arbeitslosigkeit und einer niedrigen Kapitalrendite auffallen, so ist jenseits der amorphen offiziellen Beifallsbekundungen doch erkennbar, daß der Euro vor allem Irritationen auslöst. Die Einladung des einstigen republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, an Großbritannien, sich aus Anlaß seiner Euro-Absenz von der EU zu verabschieden und der NAFTA anzuschließen oder Martin Feldsteins Warnung, daß der Euro zu "Konfrontationen mit den USA" führen werde und diese daher auf exklusiven Beziehungen zu den individuellen EU-Regierungen ohne Brüsseler Intervention beharren sollen, mögen zwar irrlichternde Ausfälle sein. Sie bringen aber auf ihre Weise die Neigung in den USA zum Ausdruck, auf eine Herausforderung, wie sie potentiell vom Euro ausgeht, eher mit an die Geoökonomie gemahnenden Abwehr- als mit Kooperationsreflexen in der Logik der Globalisierung zu reagieren.
Aber auch auf europäischer Seite sind die Voraussetzungen für eine transatlantische Währungskoordination alles andere als gut. Dem System der Europäischen Zentralbanken ist aufgegeben, seine Geldpolitik ausschließlich am Ziel der binnenwirtschaftlichen Preisniveaustabilität auszurichten. Erst danach ist es gehalten, die allgemeine Politik der Europäischen Union zu unterstützen. Die Wechselkurspolitik hingegen obliegt dem Rat der Wirtschafts- und Finanzminister, unter Einschluß auch jener vier Länder, die einstweilen nicht der Währungsunion angehören. Das gilt jedoch nur insoweit, als allein der Rat und nur einstimmig mit anderen Regierungen über formelle - wie wohl auch informelle - Währungsabkommen befinden kann, nach Konsultationen mit der Zentralbank, der Kommission und dem Parlament. Die Instrumente einer marktkonformen Wechselkurspolitik, Devisenmarktinterventionen und Zinsfestsetzungen, ressortieren wiederum bei der Zentralbank, wozu der Rat "unter außergewöhnlichen Umständen allgemeine Orientierungen" geben kann.
Damit entsteht eine für die Europäische Union nicht untypische opake Entscheidungsstruktur, die eine aktive Wechselkurspolitik allein schon deshalb verhindert, weil auf diesem wohl sensibelsten Feld der internationalen Diplomatie kostspielige Operationen in offenen Finanzmärkten ein Höchstmaß an Diskretion, Flexibilität und richtiges Timing verlangen. Es ist daher leicht eine Situation vorstellbar, in der den USA auf europäischer Seite schlicht der Adressat fehlt, um die zu erwartende Volatilität zwischen Dollar und Euro wie etwa im Juni 1998 bei der Intervention zugunsten des Yen gemeinsam regulierend einzuhegen. Daß zudem die Europäische Zentralbank - in der Tradition namentlich der interventionsfeindlichen Deutschen Bundesbank und zur Begründung ihrer politischen Unabhängigkeit - die institutionell begründete Passivität mit den Weihen einer besonderen Euro-Stabilitätskultur zu versehen geneigt ist, läßt ein aktives Währungsmanagement noch unwahrscheinlicher als in der Vergangenheit erscheinen.
Durch die Einführung des Euro werden die USA erstmals seit Jahrzehnten gezwungen sein, sich mit den Europäern auch währungspolitisch auf gleicher Ebene zu bewegen. Dabei dürfte allein der Umstand, daß die USA nicht länger über eine unilaterale Strukturierungsmacht verfügen und mehr noch, daß sie gegenüber der Europäischen Union erstmals als Demandeur aufzutreten genötigt sind, erhebliche Anpassungsprobleme aufwerfen. Diese stehen nicht nur einer gleichberechtigten Kooperation im Wege. Vielmehr haben die USA in den achtziger und frühen neunziger Jahren gegenüber Japan dokumentiert, wie sie auf die vermeintliche Intransigenz ihrer Wirtschaftspartner reagieren.
Gefahr geoökonomisch inspirierter Wirtschaftskonflikte
Daß die USA der globalisierten Wirtschaft heute das Bild ihrer ordnungspolitischen Zukunft demonstriere und daß sie unangefochten an der Spitze marschiere, wird in- und selbst außerhalb des Landes kaum in Frage gestellt: "The unique American brand of entrepreneurial bottom-up capitalism is made up of structural elements that have wrought the stunning economic success of the 1990s and are likely to provide the basis for extending America's comparative advantage over time". Vergleicht man diese keineswegs vereinzelte Stimme mit der Selbst- und der Fremdwahrnehmung vor Beginn des 1992 eingeleiteten amerikanischen Wirtschaftswunders, so könnte der Kontrast größer kaum sein. Damals befanden sich die USA in einem nachgerade hoffnungslosen Abwehrkampf gegen die unwiderstehliche Dynamik des "kommunitaristischen Kapitalismus" germanischer oder japanischer Prägung, zerfiel die Weltwirtschaft in eine Triade konkurrierender Wirtschaftsblöcke, in der die USA neben Europa und Ostasien allenfalls noch einen der drei regionalen Winkel zu besetzen vermochten.
Das Ende des Ost-West-Konflikts traf zu Beginn der neunziger Jahre mit den USA auf eine Nation, die jenseits der Sowjetunion zwar politisch-militärisch als einzige Supermacht verblieb, sich ökonomisch hingegen in einem säkularen Abstieg befand. Aufgrund ihrer "Verschuldungssucht", die innerhalb weniger Reagan-Jahre den weltweit größten Kreditgeber in der Welt größten Schuldner verwandelt hatte, und aufgrund mangelnder Investitionsbereitschaft, gleich ob im Kapitalstock, in der Infrastruktur oder in Erziehung und Wissenschaft, war aus der ehemals unangefochten führenden eine "abhängige" Nation geworden - finanziell wie technologisch. Nicht nur, daß die USA ein seit Mitte der achtziger Jahre nahezu regelmäßig auf über 100 Milliarden US-Dollar angestiegenes Leistungsbilanzdefizit vom Ausland finanzieren lassen mußten, sie hatten auch ihre technologische Führung eingebüßt - mit nicht minder gravierenden Konsequenzen etwa für die Autonomie der amerikanischen Verteidigung.
Die allenthalben beklagten strukturellen Schwächen der USA, namentlich die geringe Spar- und die übertriebene Konsumneigung, die Vernachlässigung des Humankapitals sowie die kurzfristige und kurzsichtige Renditeorientierung der Unternehmen, machten spiegelbildlich die nicht minder idealisierten strukturellen Stärken ihrer herausragenden Rivalen und insbesondere Japans aus. Japan, so hatte es Ende der achtziger Jahre den Anschein, gehörte als größtem Kreditgeber, ausgestattet mit offenbar gegen jegliche Währungsverschiebung resistenten Handelsüberschüssen, mit den damals zehn größten Banken der Welt und mit einer um 20% höheren Börsenkapitalisierung als die USA, sowie als dominierender Macht in allen Spitzentechnologien die Zukunft. "Japan has achieved a dynamic virtuous cycle of political economic power over the United States" - so ein resignierter Befund. In gemessenem Abstand folgten Deutschland und die gerade der "Eurosklerosis" entronnene Europäische Gemeinschaft/Union, die trotz eines ähnlich hohen (deutschen) Leistungsbilanzüberschusses allerdings weniger alarmistisch porträtiert wurden.
Keineswegs nur außen- und handelspolitische Falken sahen damit eine neue internationale Hierarchie aufscheinen und das weltpolitische Gewicht der USA akut gefährdet: "Wholly or partly as a result of its reduced economic standing, the United States is perilously close to being unable to play a serious role - let alone a leading one - in a growing number of global issues". Eine übereinstimmende Diagnose muß indes nicht zur gleichen Therapie führen. Hier trennten sich liberale Multilateralisten, die wie Fred Bergsten für eine neue internationale Wirtschaftsordnung auf der Basis von "shared leadership and mutual responsibility" plädierten, von jenen, die geoökonomischen Denkmustern verpflichtet waren. Namentlich Japan verfolge eine "Strategie des Wirtschaftskrieges" - so die unablässig und reichlich verzerrt wiedergegebene Botschaft des als Kronzeugen bemühten japanischen Politikers Shintaro Ishihara. Ihm müsse daher mit den gleichen Mitteln entgegen getreten werden, denn mit Japan sei weder ein "freier" noch ein "fairer" Handel möglich. Das erfordere zum einen eine strategische Neuorientierung im Sinne einer (merkantilistischen) "aggressiven Handelspolitik" unter Abkehr von jener neoklassischen Orthodoxie, die darauf hinauslaufe, daß die Offenheit der amerikanischen Wirtschaft ausgebeutet werde und diese immer weiter zurückfalle; und es verlange zum anderen, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik konzertiert, will heißen: unter Umkehrung der im Kalten Krieg geltenden Prioritäten, zu betreiben.
Daß dies weit mehr als intellektuelle Wichtigtuerei war, zeigte die vor allem geoökonomisch inspirierte Praxis der amerikanischen Handelspolitik, von weitergehenden Forderungen nach einem komplementären sicherheitspolitischen Isolationismus ganz zu schweigen. Schon während der Amtszeit von Ronald Reagan, jeglicher staatlicher Bevormundung des Marktes demonstrativ abhold, gewannen protektionistische Reflexe drastisch an Gewicht. Selbstbeschränkungsabkommen, Textil- und Stahlquoten, Anti-Dumping-Verfahren und Strafzölle führten dazu, daß Ende der achtziger Jahre mit 24% bereits doppelt so viele Importe der USA Restriktionen unterworfen waren wie zu Beginn seiner Amtszeit. Unter der Bush-Administration wurde dieses Muster, wie bereits 1986 beim Halbleiter-Abkommen mit Japan praktiziert, mit rhetorischem Nachdruck aber nur begrenztem Erfolg auf die amerikanischen Exporte ausgedehnt - in Ausführung des "Omnibus Trade and Competitive Act" von 1988 und mit Hilfe der sogenannten "Structural Impediments Initiatives Talks", einer Variante des seinerzeit populären "Japan bashing". Und auch die Clinton-Administration hielt es besonders in ihrer ersten Amtszeit für geboten, die binnenwirtschaftliche Rekonstruktionsagenda um außenwirtschaftlichen Uni- und Bilateralismus im Sinne eines "managed trade" zu ergänzen. Im Unterschied dazu erwies sich die ebenfalls beschworene "Festung Europa" weithin als amerikanische Projektion.
Es gehört zu den klassischen Begleiterscheinungen wirtschaftlicher Rezessionen, daß internationaler Wettbewerb als Nullsummenspiel und die ihm verdankten absoluten Vorteile lediglich als Illusion der ökonomischen Zunft erscheinen. Wenn nicht Zuwächse verteilt, sondern Besitzstände in Frage gestellt werden, rücken zwangsläufig die relativen Vorteile und damit das Leistungsvermögen der individuellen Nationalökonomien in den Mittelpunkt. Das mußte um so mehr für die USA gelten, als dort eigene quantifizierbare Defizite so sichtbar mit externen Herausforderungen, ja mit der Gefahr externer Fremdbestimmung namentlich durch "Dr. Frankensteins Kreatur" Japan, korrespondierten.
Allerdings blieb dies ebenso Episode wie die konfrontativen Politikempfehlungen der Krisen-Epigonen, die in jener Zeit zwar die Washingtoner politische Agenda bestimmen, bei deren Umsetzung jedoch dank innerer und äußerer Korrektive nur begrenzt Erfolge aufweisen konnten. Rückblickend befindet sich die amerikanische Wirtschaft bereits seit Herbst 1982 in einer "nachhaltigen Expansionsphase", verdient die "flache und kurze Rezession" 1990/91 kaum mehr diesen Namen. Auf frappierende Weise machte der amerikanische Unsicherheitskomplex einem neuerlichen Triumphalismus Platz, konnten sich die USA erneut den Luxus eines "consumers of last resort" zur Ankurbelung der vom asiatischen Virus befallenen Weltwirtschaft leisten. Noch Anfang der neunziger Jahre galten das japanische und auch das deutsche Wirtschaftsmodell als uneinholbar überlegen, gerade weil sie auf gesellschaftlichem Konsens und der ordnenden Hand des Staates beruhten. Mit den amerikanischen Waffen waren diese nicht zu schlagen, allenfalls einzuhegen durch multilaterale Koordination im positiven oder durch die (populärere) Forderung nach Reziprozität und die Androhung von Vergeltung im negativen Sinne. Davon ist heute im Zeichen der "Globalisierung", beiderseits des Atlantik wie des Pazifik verstanden als globale Verlängerung des amerikanischen Modells einer "neuen Ökonomie", keine Rede mehr. Über den Markt ist die alte Hierarchie wiederhergestellt, das angelsächsische Leitbild auch ohne geoökonomische Kraftanstrengungen rehabilitiert - bis auf weiteres.
Allerdings haben geoökonomische Reaktionsmuster damit keineswegs ausgedient. Sollte der Euro die amerikanische Handlungsfreiheit in den kommenden Monaten von außen spürbar einschränken und sollte der asiatische Virus über Lateinamerika die amerikanische Konjunktur erlahmen und die konsumtreibende Spekulationsblase platzen lassen, so würden schnell die fortbestehenden strukturellen Defizite offenbar und würden jenseits des aktuellen Triumphalismus geoökonomische Reflexe erneut die Überhand gewinnen. "Euro bashing" und eine Revitalisierung der latenten protektionistischen Stimmungen wären die nahezu zwangsläufige Folge.
Noch ist es nicht soweit, denn noch vagabundiert zuviel Kapital auf der Suche nach einem sicheren Hafen um den Globus, und noch hat der Euro kein eigenes Profil entwickeln können. Die fortdauernden transatlantischen Auseinandersetzungen um die Bananenmarktordnung der Europäischen Union dokumentieren jedoch, daß schon jetzt die Instrumente für geoökonomisch inspirierte Wirtschaftskonflikte bereitliegen. Dabei ist nicht nur bemerkenswert, daß die USA bekanntlich nicht zu den prominenten Exporteuren von Bananen gehören, über die von ihren Unternehmen in Zentralamerika betriebenen Plantagen folglich nur indirekt betroffen sind. Nicht minder signifikant ist der Unilateralismus, mit dem durch einseitige Sanktionsdrohungen der zugegeben zeitraubende Streitschlichtungsmechanismus des multilateralen Regimes der Welthandelsorganisation umgangen werden soll. Und mit den europäischen Exportrestriktionen für hormonbehandeltes Rindfleisch bahnt sich bereits der nächste transatlantische Konflikt an.
Handelt es sich hier um originäre Handelskonflikte, so gibt es eine nicht geringere, vor allem vom amerikanischen Kongreß forcierte Neigung, Wirtschaftsbeziehungen auch als Waffe für außenpolitische Ziele und dabei selbst gegen verbündete Staaten einzusetzen. Prominenteste Beispiele sind jene Gesetze, die mit den Namen Helms-Burton und D'Amato versehen, alle Betriebe abzustrafen verlangen, die wirtschaftlich in Kuba oder in "rogue states" wie Iran und Libyen aktiv sind. Gleich, ob es hier, wie von der "National Association of Manufacturers" der USA behauptet, mit 61 allein in den Jahren von 1993 bis 1996 eine dramatische Zunahme einseitiger, außenpolitisch motivierter Sanktionen gegeben hat, die heute 35 Länder mit über 40% der Weltbevölkerung treffen, oder ob es sich tatsächlich nur um neun neue Sanktionen höchst begrenzter Reichweite handelt, wie der Vorsitzende des Senatsausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, Jesse Helms, erläutert, unbestritten sind die geoökonomischen Reflexe der einzig verbliebenen Supermacht: "The ability to threaten and impose unilateral economic sanctions is a vital tool of U.S. trade policy, just as it is in U.S. foreign policy." Ausgestattet mit der moralischen Autorität der nach offizieller Lesart "indispensable nation" verwandeln sich partikulare umstandslos in allgemeine Interessen, wird nationale Handlungsfreiheit der USA zur Bedingung internationaler Stabilität und Ordnung der Sieg des "unipolar moment", auf das nun der Euro trifft.
Für eine Institutionalisierung währungspolitischer
KooperationDer Euro globalisiert Europa. Das ist nicht defensiv gemeint, wonach nationale Souveränität im Zuge der Globalisierung lediglich noch eine "Verhandlungsressource" gegenüber anderen Staaten darstellt und sich in supranationalen Arrangements verliert. Vielmehr ist es offensiv zu verstehen, mit einer geoökonomischen Konnotation. Die gemeinsame Währung schirmt die Mitglieder der Euro-Zone gegen destabilisierende Einwirkungen von außen ab. Sie gewinnen Handlungsfreiheit. Zugleich nimmt ihr kollektives währungspolitisches Gewicht zu. Sie gewinnen Verhandlungsmacht. Beides tangiert vor allem die USA und damit das transatlantische Verhältnis.
Die nationalen Regierungen dies- und jenseits des Atlantik sind und bleiben die letzte Instanz, die, partiell und bis heute unzulänglich durch die von ihnen geschaffenen internationalen Institutionen mediatisiert, die Rahmenbedingungen für das Handeln der Wirtschaftssubjekte setzen. Auch wenn im Zuge der Marktintegration die Welt als Referenz für ökonomische Entscheidungen auch der Regierungen zunehmend an Bedeutung gewinnt, so hat die Globalisierung daran nur graduell, nicht aber prinzipiell etwas geändert. Eine globalisierende Harmonisierung nationaler Wirtschaftspolitiken steht einstweilen aus. Mithin bringt die kollektive Verpflichtung auf ein liberales Welthandels- und Finanzsystem aktuell gleichlaufende nationale Präferenzen zum Ausdruck. Intentionen aber wandeln sich bekanntlich schneller als Fähigkeiten. Sie sind daher keine Garantie gegen einen neuerlichen Protektionismus, sei es im Zuge der Revitalisierung latenter geoökonomischer Reflexe, sei es im Zuge politischer Erschütterungen durch internationales Systemversagen oder nationale Krisen.
Auf der anderen Seite ist die Geoökonomie zwar in der Denkschule des Realismus, nicht aber in der Realität ein den Staaten gleichsam naturgegebenes Verhaltensmuster, um sich in einem militärisch neutralisierten Umfeld gegen die allerorten lauernden - oder imaginierten - Gefahren zu behaupten. Die Wirtschaft jenseits politischer Konfrontation in den Dienst nicht nur der Wohlstandsmehrung, sondern auch der Machtakkumulation- und projektion zu nehmen, dazu gehört mehr. Allein schon wegen der damit verbundenen Kosten gewinnen relative Vorteilskalküle erst dann ausreichend Schubkraft, wenn eigener wirtschaftlicher Abstieg sich so überzeugend mit wirtschaftlichem Aufstieg andernorts verbindet, daß auch eine imaginierte Gefahr zur realen politischen Kraft werden kann. Die USA boten hier in den neunziger Jahren reichlich Anschauungsmaterial.
Die japanische Herausforderung war konjunkturell und wurde strukturell zu einem Angriff der "nichtkapitalistischen Marktwirtschaft" auf die amerikanische Zivilisation überhöht. Gleichwohl mobilisierte dies in der amerikanischen Öffentlichkeit ganz im Sinne der geoökonomischen Präskription alarmistische Reaktionen, die ihre Spuren auch in der Administration hinterließen. Das ging zwischenzeitlich so weit, daß die Diskrepanz zwischen sicherheitspolitischer Kooperation und ökonomischem Konflikt allein noch aufgrund der alternativlosen Abhängigkeit Japans in seinem fragmentierten Umfeld moderiert werden konnte.
Die europäische Herausforderung, wie sie mit Einführung des Euro aufscheint, ist im Unterschied dazu strukturell, mit gegenwärtig noch eingebauter konjunktureller Bremse. Solange die unmittelbare Erfahrung fehlt, wird sich daran nichts ändern, wird der Euro aus der Ferne ein vor allem für die Europäer riskantes Einigungsexperiment bleiben. Eine Kombination jedoch aus realer währungspolitischer Machtverschiebung und konjunktureller Abschwächung schafft jenseits des Atlantik Verunsicherung und damit einen nachgerade idealen Boden für neuerliche geoökonomisch inspirierte Reaktionen. Sie können sich, wenn nicht rechtzeitig kooperativ eingehegt, leicht zu einer Eskalationsspirale und damit zu einer umfassenden politischen Krise ausweiten.
Hegemonie mag zwar die Schaffung eines liberalen Weltwirtschaftssystems und die kooperative Eingliederung nachgeordneter Mächte erleichtern. Sie stellt aber keine auflösende Bedingung dar. Eine solche Vorstellung beruht - wie in der Theorie der hegemonialen Stabilität angelegt - vielmehr auf einer rückblickenden Idealisierung der Pax Britannica cum Americana. Sie krankt daran, daß offene Systeme weniger den individuellen Vorteilskalkülen des Hegemon zugeschrieben werden, denn als Opfergang erscheinen, der anderen Mächten den Aufstieg ebnet und in seinem Niedergang kulminiert. Eine solche Konstellation war zwar eingangs der siebziger Jahre eingetreten und leitete das Ende des Bretton-Woods-Systems ein. Auch akzentuiert sie nolens volens relative Vorteile und weckt protektionistische Abwehrreflexe. Daß sich ein solches System in konkurrierende Handels- und Machtblöcke auflöst, ist jedoch, wie die vergangenen dreißig Jahre gezeigt haben, nicht zwingend - unbeschadet auch des in Gestalt der Sowjetunion und ihres Blocks seit 1989 verlorenen gegnerischen "fédérateurs".
Allerdings ist ohne unipolare Referenz das kooperative Management einer Freihandelsordnung sehr viel anspruchsvoller und geht mit der Bereitschaft, partielle Souveränitätseinbußen zu akzeptieren, einher. Eine international kooperative Wirtschaftspolitik setzt voraus, daß eigene konjunkturelle wie strukturelle Schwächen nicht umstandslos nach außen projiziert werden, daß - in realistischer Diktion - die ökonomische "Logik des Wettbewerbs" gegen die staatliche "Logik des Konflikts" abgeschirmt bleibt. Das wiederum erfordert, daß Kooperation nicht lediglich punktuell nach Maßgabe nationaler Opportunität erfolgt, sondern institutionalisiert wird. Für den internationalen Handel gibt es in Gestalt der Welthandelsorganisation eine solche Institution bereits, auch wenn diese Unilateralismus keineswegs zu beseitigen vermochte. Die internationalen Währungsbeziehungen sind hingegen in des Wortes doppelter Bedeutung dereguliert. Auch mit den vom amerikanischen Kongreß gebeutelten internationalen Finanzinstitutionen wie Währungsfond und Weltbank verfügen sie über keinen vergleichbaren institutionellen Rahmen.
Der Euro schafft nicht nur eine zweite Weltwährung, sondern auch ein Dilemma. Auf mittlere Sicht transformiert er die gegenwärtige unipolare in eine bipolare Weltwährungs(un)ordnung und löst damit zumindest die Symmetriebedingung für Kooperation ein. Kurzfristig jedoch mobilisiert er Nullsummen-Kalküle. Um diese nicht geoökonomisch eskalieren zu lassen und um zugleich Voraussetzungen auch für eine spätere Koordination zu schaffen, ist ein institutionalisierter Austausch dringend erforderlich.
Prinzipiell bietet sich für die wechselseitige Information und das kooperative Management der Währungsbeziehungen der flexible Rahmen der G-7 an. Doch würde sich diese damit noch mehr in der Beliebigkeit einer variablen Geometrie mit zudem weithin zeremoniellem Zuschnitt verlieren. Vorzuziehen ist daher ein neuer, von der G-7 separierter institutioneller Rahmen in Gestalt einer G-3 aus den Notenbank-Gouverneuren und Finanzministern der USA, Japans sowie mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank und dem vorsitzenden Finanzminister der Euro-11. Von seiten der Europäischen Währungsunion wären folglich nicht die einzelnen Mitgliedsländer und es wäre auch nicht der potentielle Beitrittskandidat Großbritannien vertreten. Ob, wie in jüngster Zeit gerade auch von deutscher Seite verstärkt vorgetragen, ein solcher institutionalisierter Austausch in die Vereinbarung verbindlicher Zielzonen für die beteiligten Währungen münden sollte, mag offen bleiben. Dem stehen grundsätzliche Zweifel an der Praktikabilität und einstweilen noch der Vorbehalt namentlich von seiten der USA entgegen, die nationale geldpolitische Souveränität nicht internationalen Arrangements opfern zu wollen. Ein verstetigter trilateraler Austausch stellt aber mit der Perspektive einer auch makroökonomischen Koordination das logische Komplement zur notwendigen fiskal- und wirtschaftspolitischen Harmonisierung in der Europäischen Währungsunion dar. Er wäre damit zugleich ein Beitrag zu deren Konsolidierung. Und er könnte jenen Projekten den Weg bereiten, die unter dem Etikett eines "Neuen transatlantischen Marktes" oder weniger ambitioniert einer "Transatlantischen Wirtschaftspartnerschaft" gegenwärtig ventiliert, nicht aber ernsthaft verhandelt werden. Den Euro dergestalt kooperativ einzuhegen bedeutet schließlich nicht zuletzt, einer möglichen geoökonomisch inspirierten Überholung bestehender Allianzen frühzeitig den Wind aus den Segeln zu nehmen.

© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition juliag | April 1999
