


International Politics and Society 2/1999
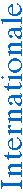
FRIEDRICH HEINEMANN
Steuerpolitik im Euro-Binnenmarkt: Harmonisierung oder Wettbewerb?
Vorläufige Fassung / Preliminary version
Die Bewertung des Phänomens Steuerwettbewerb in der akademischen und politischen Debatte könnte gegensätzlicher nicht sein. Für die einen führt die mangelnde Koordinierung nationaler Steuerpolitik zu einem ruinösen Wettbewerb, welcher dem Sozialstaat aber auch der Finanzierung notwendiger öffentlicher Güter die Grundlage entzieht. Für die anderen ist dieser Wettbewerb - in Analogie zum Wettbewerb auf Märkten für private Güter - ein hochwillkommener Mechanismus, der die Politik unter heilsamen Leistungsdruck setzt und Bürger und Unternehmen vor der fiskalischen Ausbeutung bewahrt. Entsprechend gegensätzlich sind auch die wirtschaftspolitischen Schlußfolgerungen. Während die Kritiker des Steuerwettbewerbs für eine weitgehende Koordinierung der Steuerpolitik auf europäischer oder sogar OECD-Ebene plädieren, sprechen sich die Befürworter der Wettbewerbslösung für eine Fortdauer der nationalen Autonomie in der Steuerpolitik und gegen jegliche politische Harmonisierung aus. Ihr Hauptargument besteht darin, daß dieser Wettbewerb für den Steuerzahler Schutz vor übermäßiger Steuerbelastung biete. Der Gedanke, daß somit der Steuerwettbewerb den Bürger vor der "fiskalischen Gier" des "Leviathan-Staates" schützt, hat in der angelsächsischen Literatur eine lange Tradition. Wie in vielen derart zugespitzten Debatten bleibt auf beiden Seiten manchmal die Sorgfalt in der Argumentation auf der Strecke. Vor diesem Hintergrund ist es Ziel dieses Beitrags, die grundlegenden Argumente dieser Debatte darzustellen und auf ihre Plausibilität zu überprüfen, um auf dieser Basis einige wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen zu ziehen.
Fiskalstaaten entstanden in geschlossenen Volkswirtschaften
Die Auseinandersetzung um den Steuerwettbewerb ist eingebettet in die generelle Globalisierungsdebatte. Die Prozesse, die unter dem Begriff der Globalisierung zusammengefaßt werden, tragen dazu bei, daß die Bedeutung nationaler Grenzen als Hindernisse für wirtschaftliche Aktivitäten und Verlagerungen von Produktionsfaktoren an Bedeutung verlieren: Sinkende Transport- und Kommunikationskosten, aber auch der Abbau von tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen im Rahmen der Welthandelsorganisation und der EU tragen zu dieser Internationalisierung bei. In Europa ist mit der Einführung einer gemeinsamen Währung die währungsbedingte Segmentierung des Binnenmarkts überwunden. Gerade diese letzte Veränderung ist Anlaß dafür, daß das Thema Steuerwettbewerb mit zunehmender Intensität diskutiert wird.
Tatsache ist zunächst, daß viele Eigenheiten nationaler Steuersysteme in einer Zeit geformt wurden, die durch Abschottung und Protektionismus gekennzeichnet war. Der moderne Steuer- und Wohlfahrtsstaat ist in vielen Industrieländern in den dreißiger Jahren entscheidend geprägt worden - in einer Phase also, in der Staatsgrenzen oftmals nahezu unüberwindliche Hindernisse für Kapital und Arbeit darstellten. In den ersten Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg belegen viele Indikatoren - Zinsunterschiede, Außenhandelsströme, Finanz- und Realkapitalmobilität - , daß zunächst die Offenheit wichtiger Volkswirtschaften noch sehr gering war. Erst seit den Siebzigern ist allmählich die Öffnung in den Industrieländern und auch zunehmend in den Schwellen- und Entwicklungsländern erfolgt. Der heute erreichte Offenheitsgrad ist in langfristiger Perspektive zwar nichts völlig Neues: Wirtschaftshistoriker verweisen darauf, daß die Jahrzehnte um die Jahrhunderwende bereits eine Ära der Globalisierung waren. Allerdings kann man aus dieser Ära wenig für die Frage nach den Konsequenzen der Globalisierung für die öffentlichen Finanzen lernen, weil es damals keinen Fiskus gab, der quantitativ dem modernen Staat mit seiner Steuer- und Abgabenlast auch nur entfernt gleichgekommen wäre. Die Kombination von Globalisierung und massiver Umverteilungs- und Produktionsaktivität des Staates ist neu. Entsprechend hoch ist heute die Unsicherheit in der Beurteilung.
Im folgenden sollen vor allem zwei Thesen zur Beurteilung des Steuerwettbewerbs beleuchtet werden, die sich mit den beiden grundlegenden Bereichen staatlicher Aktivität befassen - der Bereitstellung öffentlicher Güter und der Umverteilung im Rahmen des Sozialstaats:
- These 1: Der Steuerwettbewerb führt zu einem ineffizienten Angebot an öffentlichen Gütern.
- These 2: Der Steuerwettbewerb gefährdet den Sozialstaat.
Steuerwettbewerb und das Angebot an öffentlichen Gütern
Engt der Steuerwettbewerb die Möglichkeit von Staaten ein, die erforderlichen Einnahmen zur Bereitstellung eines optimalen Maßes an öffentlichen Gütern (z.B. Infrastruktur, Rechtsordnung, Ausbildungssystem etc.) zu erzielen? Hier scheint oftmals von einem zu einfachen Modell ausgegangen zu werden, in dem sich Unternehmen oder Arbeitnehmer einfach den Staat mit der niedrigsten Abgabenlast suchen. Wenn dies so wäre, dann würden tatsächlich die Steuern nach unten konkurriert und die Finanzierung der öffentlichen Güter unmöglich gemacht.
Das einfache Modell der Steuerminimierung greift allerdings wesentlich zu kurz, weil hier die Ausgabenseite des Staates im Nutzenkalkül von Unternehmen und Arbeitnehmern nicht berücksichtigt wird. Daß dies ein unzureichender Ansatz ist, wird deutlich, wenn man etwa die Standortentscheidung eines Unternehmens betrachtet. Ein Unternehmen betrachtet einen Standort nicht alleine nach der Höhe der Steuern. Neben einer Vielzahl anderer Faktoren, welche in eine Standortentscheidung eingehen, wird das Unternehmen fragen, ob die Höhe der Besteuerung in einem angemessenen Verhältnis zur Qualität der öffentlichen Güter im betreffenden Land steht. Es geht also im Standortwettbewerb nicht um eine einfache Steuerminimierung in Richtung null, sondern um ein möglichst optimales Verhältnis zwischen Steuerbelastung und öffentlicher Leistung. Steuerfinanzierte Infrastruktur, welche die Produktivität eines Standorts positiv beeinflußt, erhöht auch die Bereitschaft von Unternehmen, bei einer Entscheidung zugunsten des betreffenden Landes anschließend die entsprechende Steuerbelastung in Kauf zu nehmen.
Value for money?
Erweitert man so das zu einfache Modell vom eindimensionalen Steuerwettbewerb zum zweidimensionalen Modell des Standortwettbewerbs, dann ist also nicht notwendigerweise der Niedrigsteuerstandort der Favorit, sondern der Standort, an dem am meisten "value for money" geboten wird. Damit hat auch ein Hochsteuerland wie Deutschland so lange eine Chance, wie diesen überdurchschnittlichen Kosten auch überdurchschnittliche öffentliche Leistungen gegenüberstehen. Ein Niedrigsteuerstaat wird umgekehrt kaum attraktiv sein, wenn dort aufgrund der schlechten öffentlichen Finanzlage wesentliche Infrastruktureinrichtungen fehlen oder etwa die Rechtssicherheit und der Eigentumsschutz nicht gewährleistet werden können.
Mit dieser umfassenderen Sichtweise wird deutlich, welches Land ernsthafte Probleme bekommen muß: Wo die Steuerlast hoch ist, weil etwa in hohem Maße Subventionen bezahlt werden, die nur wenigen Interessengruppen zugute kommen, dort werden tendenziell die Unternehmer, das Kapital und die Arbeitnehmer abwandern. Auch ein Standort mit einer ineffizienten Verwaltung, wo öffentliche Leistungen überteuert produziert werden, wird dies durch Abwanderung zu spüren bekommen. Die negative Direktinvestitionsbilanz Deutschlands kann also nicht einfach mit dem hohen Niveau der Unternehmenssteuern begründet werden. Abgesehen davon, daß bei der Standortwahl ein ganzes Bündel von Faktoren berücksichtigt wird, scheint der Preis, den ein Unternehmen in Deutschland für die deutsche Infrastruktur über die Steuerlast zu bezahlen hat, unangemessen hoch auszufallen. Ein illustratives Beispiel aus dem weiten Feld der deutschen Subventionen: Die Attraktivität des deutschen Standorts leidet an den Steinkohlesubventionen. Ein Unternehmen muß zwar durch seine Steuerzahlungen zu deren Finanzierung beitragen, ihm erwächst aus diesen Ausgaben aber keinerlei Vorteil für die eigene Produktion in Deutschland.
Im um die Ausgabenseite erweiterten Modell des Steuerwettbewerb gelten Steuern also gewissermaßen als Preis für eine Gegenleistung, nämlich die in einem Land bereitgestellten öffentlichen Güter. Angesichts der Tatsache, daß eine Vielzahl an öffentlichen Leistungen in vielen Industrieländern sicher nicht zu geringstmöglichen Kosten produziert werden, ist diese Implikation prinzipiell in hohem Maße begrüßenswert. Angesichts hoher Staatsquoten ist es sinnvoll, daß ein dauernder Druck auf Effizienzverbesserungen im Bereich staatlicher Aktivität besteht. Die heutigen Bemühungen etwa, die Verwaltung zu modernisieren und betriebswirtschaftliches Denken in Behörden zu implementieren, können als positive Folgen dieses Standortwettbewerbs gewertet werden.
Die Drohung der Bürger und der Unternehmen, bei schlechten Leistungen des Staates einfach abzuwandern spielt also insgesamt eine disziplinierende und nützliche Rolle: Politik und Verwaltung geraten unter Wettbewerbsdruck, unproduktive Ausgaben zu verringern und die öffentlichen Leistungen kostengünstig zu produzieren. Mit dieser Perspektive wird aber auch klar, daß der Steuerwettbewerb zwischen Staaten zumindest im Grundsatz eigentlich ebenso günstig beurteilt werden muß wie der Wettbewerb zwischen privaten Unternehmen: Es ist unlogisch, den Wettbewerb im privatwirtschaftlichen Bereich mit allen Mitteln etwa der Wettbewerbskontrolle zu sichern, die Staaten aber daraus entlassen zu wollen. Wettbewerb ist für Politiker eine genauso unverzichtbare Rahmenbedingung wie für Unternehmen. Diese positive Bewertung des Standortwettbewerbs basiert in den Wirtschaftswissenschaften gerade auch auf den Erkenntnissen der Public-Choice-Schule: Gemäß dieser Denkrichtung verfolgen Politiker und Bürokraten nicht ohne weiteres mit ihrem Handeln das Ziel einer Gemeinwohlmaximierung. Zunächst betreiben auch die Akteure im öffentlichen Sektor Eigennutzmaximierung. Inwieweit Eigennutz- und Gemeinwohlmaximierung identische Ergebnisse zur Folge haben, hängt entscheidend von den Nebenbedingungen politischen Handelns ab. Die Nebenbedingungen, die aus einem intensiven Standortwettbewerb erwachsen, begrenzen den Spielraum der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, etwa durch Erhaltungssubventionen bestimmte Interessengruppen zu pflegen und setzen diese Akteure unter Druck, ständig nach Wegen zur Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der öffentlichen Aktivität zu suchen.
Unfairer Standortwettbewerb
Die positive Beurteilung des Standortwettbewerbs beruht nun aber entscheidend darauf, daß eine Annahme erfüllt ist: Für einen fairen und effizienten Standortwettbewerb ist es eine zwingende Voraussetzung, daß das sogenannte Äquivalenzprinzip erfüllt ist. Dieses Prinzip besagt, daß die Nutznießer der öffentlichen Güter eines Land auch in diesem Land Steuern zahlen. Das Äquivalenzprinzip kann etwa dann verletzt sein, wenn Infrastrukturinvestitionen in einem Land positive Effekte auch in einem anderen Land zur Folge haben. In diesem Fall könnte der Wettbewerb zwischen Staaten dazu führen, daß es zu einer unzureichenden Versorgung mit Infrastruktur kommt. Diese Problematik mag auf der regionalen Ebene hier und da eine Rolle spielen - in europäischer Dimension gilt aber wohl, daß die Infrastruktur des einen Staats nur sehr begrenzt auch für Unternehmen in einem anderen Staat nützlich ist.
Unfairer Wettbewerb ist aber auch dann gegeben, wenn ein Haushalt oder ein Unternehmen zwar die Infrastruktur eines Landes nutzt, aber nicht zur Finanzierung dieser Infrastruktur herangezogen wird. Ein derartiger Wettbewerb würde tatsächlich die Gefahr mit sich bringen, daß es aufgrund dieser Trittbrettfahrerproblematik zu einem suboptimalen Angebot an öffentlichen Gütern kommen kann. Beispiele für ein solches Versagen des Standortwettbewerbs sind gewinnverlagernde Manipulationen von Verrechnungspreisen innerhalb grenzüberschreitender Unternehmen. In multinationalen Konzernen können Gewinne durch entsprechende Preisgestaltung für Produkte und Dienstleistungen, die innerhalb des Konzerns grenzüberschreitend gehandelt werden, künstlich in den Niedrigsteuerstandort verlagert werden. Die Steuerbelastung des Konzerns wird dadurch minimiert, ohne daß Realkapital verlagert wird. Ein anders gelagerter Fall unfairen Steuerwettbewerbs geht von der Fiskalpolitik selber aus: Wenn nämlich ausländische Direktinvestoren durch Steuerrabatte angelockt werden, die ein ausländisches Unternehmen für längere Zeit von der Steuer freistellen oder zumindest - im Vergleich zu inländischen Unternehmen - deutlich niedriger besteuern. Dies würde den Tatbestand des Steuer-Dumpings erfüllen: Die staatliche Leistung - die Nutzung öffentlicher Güter - wird ohne Gegenleistung angeboten, um ein größeres Stück vom Kuchen internationaler Direktinvestitionen zu erlangen.
Abgesehen von der Unternehmensbesteuerung ist es vor allem die Besteuerung von Kapitalerträgen, die unter den derzeitigen Regelungen wohl kaum den Tatbestand eines fairen Steuerwettbewerbs erfüllt. Zwar gilt rechtlich das Wohnsitzlandprinzip, wonach ausländische Kapitalerträge eines in Deutschland Ansässigen auch deutschen Steuersätzen unterliegen. Würde dieses Wohnsitzlandprinzip tatsächlich Geltung haben, dann wäre die zentrale Voraussetzung für einen fairen Steuerwettbewerb erfüllt. Realistischerweise ist hier aber von einem großen Ausmaß an Steuerhinterziehung auszugehen, so daß das Wohnsitzlandprinzip faktisch nicht gilt. Viele Staaten legen ausländischen Anlegern keine Quellensteuer auf. Dies ermutigt zur Steuerflucht. Bei dieser Praxis handelt es sich daher um unfairen Steuerwettbewerb.
Gefahr für den Sozialstaat?
Neben den möglichen Problemen für die Finanzierbarkeit eines optimalen Niveaus an öffentlichen Gütern wird der Standortwettbewerb besonders auch als Gefahr für den modernen Sozialstaat bewertet. Diese Position wird mit Nachdruck vom Münchener Finanzwissenschaftler Hans-Werner Sinn vorgebracht: Sinn ist der Ansicht, daß der Steuerwettbewerb dem Sozialstaat die finanzielle Grundlage entziehen kann. Seine Überlegung verläuft vereinfacht folgendermaßen: Die wohlhabenden Bürger und Unternehmen verlassen einen Standort, wenn dort den Armen geholfen wird. Damit gehen einem Land, in dem der Sozialstaatsgedanke hochgehalten wird, die potenten Steuerzahler verloren, die in die Länder wandern, wo dem Manchester-Kapitalismus gefrönt wird.
Allerdings vermag diese Argument nur begrenzt zu überzeugen. Zum einen gilt: Sozialer Friede ist ein Standortvorteil. Ein Land ohne jeden Sozialstaat und mit einer entsprechenden explosiven innenpolitischen Situation würde auch für einen wohlhabenden Privatmann oder einen Konzern, der für eine langfristige Investition berechenbare Rahmenbedingungen benötigt, nicht besonders verlockend sein. Drastisch gesprochen: Dort, wo auf der Straße die Menschen um das nackte Überleben kämpfen, dort dürfte nur sehr schwer ein positives Investitionsklima entstehen. Damit gilt aber für den Sozialstaat - z.B. die Sicherung des Existenzminimums durch Sozialhilfe - tendenziell das gleiche wie für andere öffentliche Güter: Die Vorteile dieser öffentlichen Ausgaben werden in der Standortbeurteilung positiv bewertet. Ein funktionierender und effizienter Sozialstaat ist ein Aktivum im Standortwettbewerb.
Unterscheidung zwischen Umverteilung und Versicherung
Zum anderen ist klarzustellen, daß sich das Argument von Sinn nur auf einen relativ kleinen Ausschnitt aus dem ganzen Komplex des Sozialstaats bezieht: auf die echte Umverteilung etwa im Rahmen der Steuerprogression. Die Elemente des modernen Sozialstaats, die von ihrem Charakter eine Versicherungsleistung darstellen, werden vom Steuerwettbewerb nicht notwendigerweise negativ betroffen: Renten-, Unfall-, Invaliditäts-, Kranken- und Pflegeversicherungen sind von ihrem Charakter her private Güter, die keineswegs steuerfinanziert werden müssen. Wenn ein Bürger Versicherungsprämien zahlt, dann erhält er ja dafür eine individuelle Gegenleistung - den gewünschten Versicherungsschutz. Der Steuerwettbewerb gefährdet in keiner Weise die Möglichkeit, daß Menschen sich über private Versicherungslösungen gegen die Risiken von Krankheit und Invalidität absichern oder für das Alter Vorsorge treffen.
Richtig ist allerdings, daß der Steuerwettbewerb Sozialsysteme unter Druck setzt, die nach wie vor vorrangig auf staatliche und oftmals sogar planwirtschaftliche Verfahren setzen. Systeme der sozialen Sicherung, deren Kosten durch hohe Zuschüsse seitens des Fiskus abgedeckt werden müssen, sind unstrittig ein Handicap im Steuerwettbewerb. So ist das Versicherungsprinzip in weiten Teilen des deutschen Renten- und Krankenversicherungssystems durchbrochen. Beiträge in die Rentenversicherung werden aufgrund der Instabilität des Umlageverfahrens gerade von jüngeren Pflichtversicherten immer weniger als Preis für eine reelle Gegenleistung, sondern zunehmend als Steuer betrachtet. Damit wird dieses System zum Nachteil im Standortwettbewerb. Es erscheint aber verfehlt, auf der Grundlage dieses Befundes den Standortwettbewerb begrenzen zu wollen. Die angemessene Schlußfolgerung lautet viel eher, diese Systeme endlich entschlossen zu modernisieren.
Richtig ist ebenfalls, daß es im Steuerwettbewerb schwierig wird, die hohen Kosten von nicht funktionierenden Arbeitsmärkten dem Steuerzahler aufzubürden. Hier sind im internationalen Wettbewerb schneller die Grenzen der Belastbarkeit erreicht als in einer geschlossenen Volkswirtschaft. In den hohen Folgekosten der Arbeitslosigkeit liegt ja die wichtigste Ursache der aktuellen Budgetnöte der Sozialkassen begründet. Und hier kumulieren sich die inflexiblen Arbeitsmärkte zusammen mit dem Standortwettbewerb zu einem Teufelskreis: Arbeit ist weniger mobil als Kapital, und die Kosten der Arbeitslosigkeit können daher überwiegend wieder nur dem Faktor Arbeit aufgebürdet werden. Damit wird die Kapitalintensität in der Produktion erhöht und der Beschäftigungsabbau weiter forciert. Nur kann auch hier die Schlußfolgerung wieder nicht lauten, ein Land abzuriegeln. Wird der Steuerwettbewerb ausgeschaltet, dann läßt sich die Arbeitslosigkeit zwar zweifellos besser finanzieren und verwalten. Diese steuerfinanzierte Abmilderung der Folgen der Arbeitslosigkeit würde die Lösung des eigentlichen Problems - die seit langem geforderte Flexibilisierung der Arbeitsmärkte - aber eher in weitere Ferne rücken: Je besser die Arbeitslosen vom Fiskus abgesichert werden und je mehr Menschen durch weitgehend steuerfinanzierte aktive Arbeitsmarktpolitik aus der Arbeitslosenstatistik verschwinden, desto geringer der heilsame Druck auf die Tarifparteien zu einer vollbeschäftigungskonformen Tarifpolitik.
Weite Teile eines modernisierten Sozialstaats sind also sehr wohl mit offenen Grenzen und einem intensiven Standortwettbewerb vereinbar. Einschränkungen ergeben sich aber für das Ausmaß der echten Umverteilung. Wird hier etwa im Rahmen der Steuerprogression der Versuch einer starken Umverteilung betrieben, so kann dieser Versuch bei zunehmender Mobilität von Arbeitnehmern und Unternehmen konterkariert werden. Verteilungspolitische Probleme bereiten hier auch Mobilitätsunterschiede. Während Unternehmen und Finanzkapital eine hohe Mobilität aufweisen, gilt dies nur in geringerem – wenn auch steigendem - Maße für Arbeitnehmer. Mobile Faktoren werden sich tendenziell einer Steuerbelastung, die nicht gemäß dem Äquivalenzprinzip als Preis für eine Gegenleistung empfunden wird, entziehen. Die Folge ist, daß vor allem die immobilen Bewohner eines Landes die echte Umverteilung finanzieren müssen.
Unabhängig von der nur politisch beantwortbaren Frage nach dem gerechten Ausmaß der Umverteilung gilt hier aber folgendes: In dem Maße, in dem Haushalte und Unternehmen durch Reformen des Sozialsystems, durch den Abbau von Subventionen und durch Effizienzsteigerungen in der Verwaltung entlastet werden, wächst auch wieder der Spielraum für die politisch gewollte Umverteilung. Mit anderen Worten: Verfügt ein Land über einen effizienten öffentlichen Sektor, dann kann es sich auch im Standortwettbewerb ein hohes Maß an echter Umverteilung leisten.
Was sagt die Empirie?
Obwohl der Steuer- und Standortwettbewerb in aller Munde ist, gibt es hier gerade in der empirischen Dimension noch erheblichen Forschungsbedarf. Wenn die theoretischen Argumente ausgetauscht sind, sollte man die Zahlen sprechen lassen. Die bekannten Zahlen sind nicht geeignet, die These zu stützen, daß der Standortwettbewerb bereits ein Ausmaß erreicht hat, welches dem Fiskus in den Industrieländern ernsthaft die Finanzierungsgrundlage entzieht. Im Gegenteil: In den Jahrzehnten der Globalisierung seit 1970 konnte sich der Fiskalstaat in Deutschland und anderswo immer weiter ausdehnen. So stieg etwa die Staatsquote in Deutschland von 39,1 Prozent im Jahre 1970 auf 50,6 Prozent in 1995 und die Abgabenquote im gleichen Zeitraum von 34,4 auf 41,9 Prozent.
Wenn überhaupt eine Folge des Standortwettbewerbs zu messen ist, dann nicht im Niveau der staatlichen Aktivitäten, sondern in der Struktur der Einnahmeseite. Hier ist es zu einer merklichen Verlagerung von direkten Steuern hin zu Sozialabgaben gekommen. Es läßt sich argumentieren, daß dies die Folge des Wettbewerbs ist: Immobil ist vor allem der Faktor Arbeit. Weil er sich im Vergleich zum mobilen Faktor Kapital kaum durch Abwanderung gegenüber einer Mehrbelastung wehren kann, wird er in steigendem Maße durch Sozialabgaben und indirekte Steuern belastet.
Die Empirie zeigt aber auch, daß nicht die Rede davon sein kann, daß der Standortwettbewerb dabei ist, die Unternehmen aus der Finanzierungsverantwortung für die fiskalischen Aufgaben zu entlassen. International vergleichende Studien belegen zwar eine gewisse Annäherung in der Steuerbelastung von Unternehmen, aber keinesfalls eine Konvergenz der Unternehmenssteuern gegen null. Während die Unternehmenssteuern in Hochsteuerländern unter Druck geraten, konnten sie in früheren Niedrigsteuerländern steigen. Nicht uninteressant auch der Blick in die Schweiz: Die Kantone verfolgen eine in hohem Maß eigenständige Steuerpolitik, und das im völlig ungebremsten Steuerwettbewerb einer einheitlichen nationalen Volkswirtschaft. Weder die Versorgung mit öffentlichen Gütern noch die Gewährleistung eines funktionierenden Sozialstaats hat bei den Eidgenossen darunter gelitten. Wenn überhaupt, dann scheint hier der Steuerwettbewerb einen heilsamen Druck auf eine kosteneffiziente öffentliche Verwaltung ausgeübt zu haben.
In Deutschland wurden in den letzten Jahren die teilweise hohen Steuerausfälle bereits dem unfairen Standortwettbewerb zugeschrieben. Diese Diagnose ist wenig überzeugend. Obwohl gesicherte Erkenntnisse etwa im Bundesfinanzministerium nicht vorliegen, ist zu vermuten, daß die räumliche Gewinnverlagerung in Niedrigsteuerstandorte nur eine geringe Rolle im Vergleich zu den folgenden Ursachen gespielt hat: Eine Reihe von Steuerrechtsänderungen hatten Einnahmeausfälle zur Folge, die so nur schwer prognostiziert werden konnten. Beispielsweise wurden Sonderabschreibungen in den neuen Bundesländern in viel größerem Maße genutzt als dies vorhergesagt worden war. Schließlich hat die letzte Rezession in den nachfolgenden Jahren durch ein gewaltiges Volumen an Verlustvorträgen ihre Spuren im Aufkommen der Körperschaftssteuer hinterlassen. Ein Großteil der Steuerausfälle ist also weniger dem unfairen Steuerwettbewerb als inländischen Ursachen auf dem Gebiet der Steuerpolitik und der Konjunkturentwicklung zuzuschreiben. Die jüngste Erholung der Steuereinnahmen bestätigt gerade die Wichtigkeit der - mit einer erheblichen Verzögerung wirkenden - konjunkturellen Komponente.
Währungsunion und Steuerpolitik
Bevor erste wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen gezogen werden können, ist der Beginn der Europäischen Währungsunion (EWU) mit in die Überlegungen einzubeziehen. Mit dem veränderbaren nominalen Wechselkurs geht ein Anpassungsinstrument verloren, mit dessen Hilfe unterschiedliche Entwicklungen zwischen Volkswirtschaften abgefedert werden konnten. Das gleiche gilt für die nationale Differenzierung der Geldpolitik. War es in der Vergangenheit möglich, unterschiedlichen konjunkturellen und strukturellen Situationen in den EU-Mitgliedstaaten auch durch unterschiedliche Geldmarktzinsen zu begegnen, so gibt es im Euro-Raum nur noch den einheitlichen Zins, wie er von der Europäischen Zentralbank gesetzt wird. In dieser Situation kommt es darauf an, daß die Mitgliedstaaten wirtschaftspolitische Freiheitsgrade behalten. Neben der Forderung nach einer auch in Zukunft in hohem Maße national differenzierten Lohnpolitik ergibt sich daraus vor allem auch die Notwendigkeit einer differenzierten Fiskalpolitik. Eine Harmonisierung der europäischen Fiskalpolitik im Sinne eines Abschieds von nationalen Steuersätzen ist gerade unter den Bedingungen der EWU abzulehnen. Angesichts des Verlusts an wirtschaftspolitischer Anpassungsfähigkeit im Bereich von Geld- und Wechselkurspolitik muß der fiskalische Freiheitsgrad erhalten bleiben.
Schlußfolgerungen
Zunächst ist die klare Unterscheidung zwischen einem fairen und einem unfairen Steuerwettbewerb zu unterstreichen. Fair ist, wenn ein Staat seinen Haushalten und Unternehmen eine niedrige Abgabenbelastung bietet, weil er über eine effiziente Verwaltung und ein modernes Sozialsystem verfügt und den Staatshaushalt nicht mit Erhaltungssubventionen für alte Industrien oder sozialpolitisch kaum zu rechtfertigenden Transfers für politisch wichtige Interessengruppen belastet. Ein solcher Staat hat es durch eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik verdient, daß sich dort vermehrt Unternehmen ansiedeln, weil sie an diesem Standort "value for money" erhalten. Fair ist es spiegelbildlich folglich auch, wenn ein Staat, der nicht reformfähig ist, die Quittung in Form einer negativen Direktinvestitionsbilanz erhält. Es ist durchaus nachvollziehbar, daß die Politiker in einem reformunfähigen Land diesen Steuerwettbewerb gerne unterbinden würden. Dies würde ihnen die Pflege von Lobbies und die Verweigerung politisch schwieriger Reformen erleichtern. Die Beschränkung des Wettbewerbs stünde aber eindeutig nicht im Interesse der Bürger dieses Staates, weil der Druck auf die Durchführung notwendiger Reformen abnehmen würde. Jede Verzögerung der Reformen wird aber am Ende ihre Kosten erhöhen.
Unfair wird der Steuerwettbewerb dann, wenn das Äquivalenzprinzip klar durchbrochen wird und der Nutznießer der öffentlichen Güter eines Landes nicht auch in diesem Land als Steuerzahler zur Finanzierung herangezogen wird. Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidung ergeben sich folgende Empfehlungen:
- Die Autonomie der nationalen Steuerpolitik ist auch innerhalb der EU prinzipiell zu erhalten. Überlegungen einer generellen Mindestbesteuerung oder der Einführung einheitlicher EU-Steuern ist eine Absage zu erteilen. Derlei Vorstöße würden das Kind mit dem Bade ausschütten, weil nicht nur der unfaire, sondern auch der wünschenswerte faire Standortwettbewerb beseitigt würde. Es ist heilsam für die Kreativität und Leistungsfähigkeit der nationalen Politik, daß dieser Wettbewerbsdruck aufrechterhalten wird. Außerdem ist es nach dem Übergang zur Währungsunion wichtig, daß nach dem Verlust zins- und wechselkurspolitischer Freiheitsgrade auf dem fiskalischen Gebiet eine nationale Differenzierung möglich bleibt.
- Einen begrenzten Handlungsbedarf zur Beseitigung unfairen Steuerwettbewerbs gibt es im Bereich des Steuer-Dumpings bei der Unternehmensbesteuerung (z.B. Steuerprivilegien für ausländische Direktinvestoren) und auf dem Gebiet der Kapitalertragsbesteuerung. Die Bemühungen auf der EU-Ebene im Verhaltenskodex gegen unfairen Steuerwettbewerb oder dem neuen Anlauf zur Durchsetzung der Zinsbesteuerung gehen in die richtige Richtung. Allerdings sollten diese Bemühungen auf nationaler Ebene ergänzt werden um eine Reform der Kapitalertragsbesteuerung in Richtung des nordischen Modells: Eine im Vergleich zur Einkommensbesteuerung niedrigere Abgeltungssteuer ist ein aussichtsreicher Weg hin zu einer akzeptierten und damit auch nachhaltig ergiebigen Besteuerung der Kapitaleinkünfte.
Alle legitimen Bemühungen zur Einschränkung des unfairen Steuerwettbewerbs dürfen dabei nicht über folgendes hinwegtäuschen: Ein Land wie Deutschland, das in den vergangenen Jahren im fairen Standortwettbewerb - gemessen etwa an der Direktinvestitionsbilanz - auf der Verliererseite gestanden hat, muß sich endlich ehrlich den Ursachen stellen. Die Kosten-Nutzen-Relation der öffentlichen Aktivität ist zu verbessern. Die Modernisierung der Verwaltung ist voranzutreiben. Subventionen sind abzubauen. Der Sozialstaat ist mit der Zielrichtung einer stärkeren Berücksichtigung des Versicherungsgedankens zu modernisieren, um ihn resistent gegen Belastungen des Standortwettbewerbs zu machen. Mit einer Umstrukturierung der Einnahmeseite alleine - etwa von den Sozialabgaben in die Ökosteuer - kann dem grundsätzliche Problem einer nicht konkurrenzfähigen Kosten-Nutzen-Relation nicht erfolgreich begegnet werden. Schließlich ist die Arbeitsmarktflexibilisierung voranzutreiben, um das große Handicap, das eine hohe steuer- und abgabenfinanzierte Arbeitslosigkeit im Standortwettbewerb darstellt, abzumildern.
Das Fazit lautet: Das Maß an Steuerharmonisierung, das in der EU ökonomisch wünschenswert und im übrigen wohl auch nur politisch realistisch ist, fällt äußerst bescheiden aus. Diese begrenzte Harmonisierung wird die deutsche Wirtschaftspolitik nicht vor den Herausforderungen des Standortwettbewerbs bewahren. Insbesondere bleibt die Notwendigkeit bestehen, endlich den Reformstau der letzten Jahre zu überwinden und das seit langem hinlänglich bekannte Modernisierungsprogramm in den Bereichen Sozialversicherung, öffentliche Verwaltung, Steuer- und Arbeitsmarktpolitik in Angriff zu nehmen. Insofern wäre es schädlich, über eine zu starke Fokussierung auf die Zielsetzung einer EU-Steuerharmonisierung noch mehr Zeit bei der Einleitung dieser Reformen zu verlieren.

© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition juliag | April 1999
