


International Politics and Society 4/1998
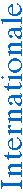
MICHAEL EHRKE
Japan: Unfähig, die Krise zu bewältigen?
Vorläufige Fassung / Preliminary version
Seit Ende 1997 sind Wirtschaftsnachrichten aus Japan Katastrophenmeldungen. "If Japan Should Crash" titelte der Economist. Ein Kommentator der Financial Times beschwor die Gefahr einer deflationären Spirale nach dem Muster der 30er Jahre. Die japanische Wirtschaft befinde sich "am Rande des Zusammenbruchs", so Sony-Präsident Ohga. Die Daten bestätigen die Katastrophenstimmung: Der Einzelhandelsumsatz sank zwischen dem 1.Quartal 1998 und dem Vergleichszeitraum 1997 um über 20%, die Wachstumsrate des Sozialprodukts wird 1988 allen Prognosen zufolge unter der Nullinie liegen - zum ersten Mal seit 1974. Die Krise, die seit Anfang der 90er Jahre schwelt, hat in den letzten acht Monaten eine Zuspitzung erfahren: Die Stagnation droht in die Depression überzugehen.
Hinsichtlich der Ursachen gibt es verschiedene Erklärungsansätze. In den Kommentaren werden, in unterschiedlicher Mischung und mit unterschiedlicher Gewichtung, meist fünf Faktoren hervorgehoben:
- Strukturelle Krise eines "Wirtschaftsmodells" : Die Probleme Japans werden als Krise des Übergangs einer außergewöhnlich schnell wachsenden, aufholenden zu einer ausgereiften Wirtschaft analysiert. Arrangements, die in den Jahrzehnten des Hochgeschwindigkeitswachstums wirtschaftliche Erfolge ermöglichten, haben sich nun in Belastungen verwandelt. In diesem Sinne lassen sich ganze Listen von Rigiditäten und Strukturdefiziten zusammenstellen, die auf die Notwendigkeit grundlegender Reformen verweisen.
- Reaktion auf den externen Schock der Asienkrise : Japan ist in seinem Außenhandel, seinen Direktinvestitionen und seinen Auslandskrediten in Asien stärker exponiert als jedes andere Industrieland. Infolge der Asienkrise schrumpfen die japanischen Exporte, die Gewinnerwartungen der Unternehmen, die in Asien investiert haben, sinken, und der Berg an Problemkrediten, auf dem die japanischen Banken bereits sitzen, vergrößert sich.
- Die restriktive Fiskalpolitik der Regierung Hashimoto : Sie wird vor allem in Japan selbst für die Verschärfung der Krise verantwortlich gemacht. Die Regierung Hashimoto identifizierte zur Unzeit das Haushaltsdefizit als wichtigstes Problem der japanischen Wirtschaft und suchte es mit Steuererhöhungen und der Restriktion der Staatsausgaben zu bekämpfen. Damit würgte sie die gerade einsetzende Erholung ab.
- Die unzureichende Dynamik des privaten Konsums und die trotz niedriger Zinsen hohe Sparrate : Diesem Phänomen liegt eine tiefgreifende Verunsicherung der Konsumenten/Sparer zugrunde, deren ihre Spar- und Konsumentscheidungen nicht mehr auf geld- und fiskalpolitische Anreize reagieren.
- Durchschlagen der Krise des Finanzsektors auf die gesamte Volkswirtschaft : Mehrere Jahre lang konnte der Schein einer Separierung der finanziellen von der realen Sphäre der Wirtschaft aufrechterhalten werden, weil das Finanzsystem auch nach dem Platzen der "bubble" als Bereich angesehen werden konnte, der besonderem staatlichen Schutz unterlag. Da Banken, Wertpapierhäuser und Lebensversicherungen davon ausgehen konnten, daß der Staat auch weiterhin den Bestand größerer Institute garantieren würde, waren die Berge an Problemkrediten eher eine theoretische Größe als ein Indikator für massive Verluste. Erst als Ende 1997 das viertgrößte Wertpapierhaus des Landes, Yamaichi Securities, bankrott ging, ohne daß der Staat intervenierte, wurde deutlich, daß auf die staatliche Bestandsgarantie für private Banken nicht mehr zu rechnen war. Erst in diesem Augenblick brach die finanzielle Vermittlungsfunktion des Bankensystems zusammen - mit dramatischen Folgen für die Realwirtschaft.
Im Folgenden sollen die beiden letztgenannten Erklärungen hervorgehoben werden. Das soll nicht heißen, daß die anderen Ansätze falsch oder irrelevant wären. Natürlich trifft es zu, daß Japan eine Strukturkrise durchmacht, und daß das "japanische Modell" unter hohem Anpassungs- und Reformdruck steht. Dies gilt seit Ende der 80er Jahre, und die entsprechende japankritische Literatur füllt bereits Bibliotheken. Dieser Ansatz erklärt jedoch nicht die akute Verschärfung der Krise. Vor allem die sich aus ihm ergebenden Handlungsanweisungen, die schon gebetsmühlenartig heruntergeleierten Appelle zu Reform und Deregulierung, werden selbst dann, wenn sie bei den Regierenden Wirkung zeigen sollten, kaum zur Krisenüberwindung beitragen, da sie auf die Verbesserung des Angebots zielen, die japanische Krise heute aber von der Nachfrage, d.h. vom privaten Verbrauch ausgeht (was nicht heißen soll, daß Reformen auf der Angebotsseite nicht sinnvoll und langfristig auch notwendig wären). Natürlich trifft es ebenfalls zu, daß die Asienkrise die Aussichten auf eine Erholung der japanischen Wirtschaft drastisch verschlechtert. Aber die Asienkrise ist nicht die Ursache der Japankrise, obwohl es Parallelen und Interdependenzen gibt. Dem fiskalpolitischen Erklärungsansatz schließlich wäre insofern zuzustimmen, als die Haushalts- und Steuerpolitik der Regierung in der Tat Schaden angerichtet hat. Der Ansatz greift aber zu kurz, weil die Besonderheit der japanischen Krise darin liegt, daß der private Verbrauch auf die Geldpolitik gar nicht und auf die Fiskalpolitik nur sehr schwach reagiert. D.h. die Regierung Hashimoto lag falsch, aber hätte sie richtig gelegen, hätte es nicht viel genützt.
Staatsausgaben und Konjunktur
In Japan wird die Zuspitzung der Krise auf die staatliche Haushaltspolitik zurückgeführt: Eine restriktive Fiskalpolitik hat den einsetzenden Aufschwung abgewürgt, so das Argument nicht nur japanischer und ausländischer Kritiker, sondern auch das Votum japanischer Wähler, die Hashimoto und seiner Liberaldemokratischen Partei in den Oberhauswahlen im Juli 1998 eine schwere Niederlage beigebracht haben. Nachdem 1996 eine Wachstumsrate von weit über 3% das Ende der Stagnation zu signalisieren schien, gleichzeitig aber als Ergebnis mehrerer Konjunkturspritzen Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung in die Höhe geschnellt waren, machte die Regierung Hashimoto den Abbau des Defizits zur ersten Priorität. Allerdings war (und ist) die private Sparrate so hoch, daß das Defizit zumindest kein akutes Problem war. Im Gegenteil trug ein defizitärer Haushalt zur Absorption von Ersparnis und zum Ausgleich der Verhältnisses von Ersparnis und Investition und damit zum Abbau der im Ausland so heftig kritisierten Leistungsbilanzüberschüsse bei. Wahrscheinlich dachte die Regierung jedoch an die ferner liegende Zukunft und versuchte die Akkumulation öffentlicher Schulden, die schon heute bei 100% des Sozialprodukts liegen, frühzeitig zu stoppen. Das Finanzministerium wird eine treibende Kraft gewesen sein, und auch ausländische Einflüsse - die Sanierung des US-Haushalts durch die Regierung Clinton und die Konsolidierungspolitik der europäischen Staaten - werden eine Rolle gespielt haben; nicht zufällig visierte Hashimoto das Maastricht-Kriterium eines Defizits von 3% des Sozialprodukts an. Zudem ließ sich die Haushaltsreform gut in das technokratische Reformprogramm der Regierung Hashimoto (das die Reform der wirtschaftlichen Regulierung, der Verwaltung, des Finanzsystems, der Sozialversicherung und des Bildungswesens vorsah) einpassen. An zentraler Stelle in diesem Zusammenhang stand die geplante (und gescheiterte) Reform des Fiscal Investment and Loan Program (FILP), des zweiten Staatshaushalts, der die Finanzierung öffentlicher Korporationen aus den Mitteln vor allem der Postsparkasse vorsieht. Eine konsequent restriktive Haushaltspolitik hätte einen Ansatz geboten, das wenig transparente Netzwerk des FILP zu entflechten - und der Bürokratie eine Grundlage ihres Einflusses zu entziehen. Und nicht zuletzt konnte das gute Ergebnis des Jahres 1996 - Japan führte hinsichtlich des Wirtschaftswachstums wieder die OECD-Länder an - als Signal für eine Wende zum Besseren bewertet werden. Dabei handelte es sich keineswegs nur um eine "self-fulfilling prophecy" der Regierung; eine ganze Reihe von Experten hatte angekündigt, daß das Land nach fünf Jahren der Stagnation nun an die Spitze der Weltwirtschaft zurückgekehrt sei.
Es schien also wenig Gründe gegen eine restriktivere Haushaltspolitik zu geben. Diese bestand in der Einschränkung der staatlichen Mittel für öffentliche Arbeiten, in einer Anhebung der allgemeinen Verbrauchssteuer von 3 auf 5%, fällig im April 1997, und in der Aufhebung von Steuererleichterungen, die 1993 aus konjunkturpolitischen Gründen erlassen worden waren. Die Steuerreform war kein originäres Projekt der Regierung Hashimoto, sie war bereits 1994 beschlossen und auf 1997 verschoben worden. Die Reaktion der Konsumenten auf die für den europäischen Beobachter eher moderate Steuererhöhung war jedoch nicht vorausgesehen worden: Der private Verbrauch ging im zweiten Quartal 1997 um 3,2% - die sich zu einer Jahresrate von mehr als 12% hochrechnen lassen - zurück, ohne sich in den verbleibenden Monaten des Jahres zu erholen.
Der Einbruch des privaten Konsums als Reaktion auf eine Anhebung der Verbrauchssteuern um gerade zwei Prozentpunkte zeigte, daß die Konjunktur falsch beurteilt worden war. Er bestätigte, daß die positive Wachstumsrate des Jahres 1996 keine Wende der Konjunktur signalisierte, sondern vor allem zwei Sachverhalte widerspiegelte: Die enormen Konjunkturspritzen des Jahres 1995 und Kaufentscheidungen der Konsumenten (insbesondere beim Erwerb von Wohnungseigentum), die wegen der angekündigten Steuererhöhung vorgezogen worden waren. Das niedrige, aber positive Wirtschaftswachstum der Vorjahre hatte, wie sich nun erwies, auf politisch induzierten Nachfragekomponenten basiert, den Staatsausgaben und dem (von der Steuerpolitik abhängigen) privaten Wohnungsbau. Damit wurde auch ein Unterschied der derzeitigen zu früheren Rezessionen deutlich: In vorausgegangenen Rezessionen hatte die politisch induzierte Nachfrage regelmäßig als Initialzündung eines sich selbst tragenden Wachstums gewirkt, das auf den unabhängigen Variablen privater Verbrauch und private Investition basierte. Diese Initialzündung war 1992-95 nicht erfolgt. Die politisch determinierte Nachfrage wurde 1997 reduziert, ohne daß sich Verbrauch und Investition erholt hatten.
Die Regierung hatte ihre Konsolidierungspolitik zu früh gestartet. Der von allen Seiten geforderte Ausweg: eine neue Konjunkturspritze. Gegenstand der Diskussion war seit Mitte 1997 nur noch die Dimension: Sie mußte ein höheres Volumen aufweisen als das letzte Konjunkturpaket vom Herbst 1995 und damit größer sein als jedes vorher verabschiedete Paket. Die Regierung reagierte auf den öffentlichen Druck zunächst zögerlich und schnürte ein Konjunkturpaket von 2 Billionen Yen. Dies war jedoch zu wenig, in der Öffentlichkeit geisterte die Zahl von 16 Billionen Yen als Minimum. Auch der äußere, d.h. der amerikanische Druck auf Japan nahm zu: Die Asienkrise, die mittlerweile ihren Höhepunkt erreicht hatte, konnte nach amerikanischer Auffassung nur überwunden werden, wenn Japan seiner "regionalen Verantwortung" gerecht wurde, seine Konjunktur belebte und die Importe der asiatischen Nachbarländer aufnahm.
Unter dem wachsenden inneren und äußeren Druck tat die Regierung Hashimoto schließlich, was ihre Vorgängerinnen auch getan hatten: Sie verabschiedete ein weiteres Paket in der Höhe der erwarteten 16 Billionen Yen - und gestand damit das Scheitern der haushaltspolitischen Konsolidierung ein. Nun konzentrierte sich die Auseinandersetzung auf die Zusammensetzung des Pakets. Wirtschaftsfachleute und US-Politiker forderten, daß ein möglichst hoher Anteil aus permanenten Steuererleichterungen und ein möglichst kleiner aus Ausgaben für öffentlichen Arbeiten bestehen müsse. Das Scheitern Hashimotos in der Haushaltspolitik und die damit verbundene politische Schwächung des Premiers öffnete jedoch das Feld für die Hinterbänkler der regierenden LDP, die ihre Chance sahen, mit den nun wieder reichlicher fließenden Haushaltsmitteln ihre lokale Klientel zu bedienen, die für den Juli 1998 vorgesehenen Oberhauswahlen im Blick. Die traditionellen LDP-Politiker mit einer meist ländlichen oder kleinstädtischen Basis (auch nach der Wahlrechtsreform von 1994 hat eine Wählerstimme der peripheren Präfektur Shimane das 2,2fache Gewicht einer Stimme aus Tokyo) sind eine natürliche Lobby für öffentliche Arbeiten: Mit der Vergabe öffentlicher Bauaufträge können sie die Unterstützung, die Stimmen und die Geldmittel der Bauwirtschaft gewinnen und ihren lokalen Hochburgen Infrastrukturdenkmäler setzen, um sich so der Loyalität ihrer Wähler zu versichern. "Politics is roads and roads is politics" - so der ehemalige Premierminister und die auch heute noch mächtige graue Eminenz der LDP, Noboru Takeshita. Nicht umsonst ist das ländliche Japan, mit Straßen, Brücken, Dämmen, Hangbefestigungen, Tunnels, Häfen und Flughäfen zugepflastert. Steuererleichterungen dagegen kommen der anonymen Bevölkerungsmehrheit zugute und tragen kaum dazu bei, die persönlichen, auf wechselseitige Verpflichtungen gründenden Bindungen zwischen Politikern und Wählern zu stärken.
Hashimoto kündigte schließlich an, 4 der 16 Billionen Yen des Konjunkturpakets würden für Steuererleichterungen eingesetzt, Nachfolger Obuchi erhöhte die Summe auf 6 Billionen. Doch nach wie vor wird der Löwenanteil wahlpolitisch motivierten Infrastruktur- und Bauprojekten zugute kommen. Die fiskalpolitische Niederlage Hashimotos hat damit die alte Logik der wahlpolitischen Manipulation des Staatshaushalts wieder in Gang gesetzt.
Das entscheidende haushalts- und konjunkturpolitische Problem Japans liegt freilich nicht darin, daß die Regierung 1997 von der Politik der Konjunkturpakete vorübergehend Abstand und sie erst nach einem Jahr Verzögerung wiederaufnahm, sondern darin, daß die Politik der Konjunkturpakete selbst ausgereizt zu sein scheint. Immer neue Konjunkturspritzen haben die japanische Wirtschaft mit Mühe über Wasser gehalten, sie haben aber nicht aus der Stagnation herausgeführt. Die Reaktion der Tokyoter Börse auf die Ankündigung des letzten Pakets vom Frühjahr 1998 - ein Kursrückgang von 0,55% - bestätigte dies (die Wirtschaftszeitung Nihon Keizai prägte den Begriff der "package fatigue"). Die Zusammensetzung dieser Pakete mag einen Teil ihrer Wirkungslosigkeit erklären: Es handelt sich um die Erhaltung oder Schaffung von Beschäftigung in der Bauwirtschaft, wobei der Grenznutzen die öffentlich finanzierten Projekte in der Tendenz abnimmt. Japan hat bereits bezogen auf die Fläche seines Territoriums doppelt so viele Landstraßenkilometer wie Deutschland und ein Vielfaches an Brücken- und Tunnelkilometern, und der Anschluß noch des letzten Winkels an die nationalen Straßen- und Schienennetze ist nicht ökonomisch, sondern nur noch wahlpolitisch zu rechtfertigen. Die negativen, wenn auch statistisch nicht exakt zu messenden Wirkungen der japanischen Konjunkturprogramme liegen in der Förderung einer wenig produktiven Industrie mit über 500.000 Unternehmen, die um ca. 30% teurer wirtschaftet als in den USA oder Europa, die von öffentlichen Mitteln abhängt, und die zusammen mit Politik und Verwaltung das härteste "eiserne Dreieck" der japanischen Wirtschaft bildet. Doch selbst wenn das letzte Konjunkturpaket ausschließlich "sinnvollen" Projekten (gefordert werden etwa der Ausbau des Glasfaserkabelsystems oder die Computerisierung der Schulen) oder den Steuerzahlern zugute käme, wäre mit einem Erfolg im Sinne einer Ankurbelung der Konjunktur kaum zu rechnen: Der größte Teil der zusätzlich geschaffenen Nachfrage wäre nicht konsumiert, sondern gespart worden.
Konsumzurückhaltung
Im Kern der japanischen Krise steht ein Paradox: Obwohl der nominale Zinssatz nahe bei Null liegt (der overnight-Marktzins lag im Mai 1998 bei 0,37%) und der Anreiz zur Bildung von Ersparnissen schwach ist, steigt die Sparrate auf Kosten des privaten Konsums. Wie erwähnt ging der Einzelhandelsumsatz zwischen den ersten Quartalen 1997 und 1998 um über 20% zurück. Die beiden entscheidenden Fragen lauten daher: Warum sparen die Japaner zu viel bzw. konsumieren zu wenig, obwohl der Zinssatz nicht zur Ersparnis anreizt? Und: Welche Wirtschaftspolitik kann aus dem Unterkonsum/der Überersparnis herausführen, wenn die Geldpolitik (unter Null kann der nominale Zinssatz nicht sinken) gar nicht und die Fiskalpolitik (die Politik der immer stärkeren Konjunkturspritzen) fast gar nicht greift.
Es gibt einige Charakteristika der japanischen Gesellschaft, die die Spar- und Konsumquote relativ unsensibel für die Anreize des Zinssatzes machen, d.h. die Haushalte zwingen, auch unabhängig von den zu erwartenden Erträgen zu sparen. Dies sind:
- Hohe Ausbildungskosten . In einer Gesellschaft, in der 46% der Berufsanfänger ein Universitätsstudium vorzuweisen haben, lastet auf den Familien ein hoher Druck, ihren Kindern den bestmöglichen Bildungsabschluß zu verschaffen. Die Ausbildungskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren für private Schulen und Oberschulen, den Gebühren für die privaten Paukschulen (an denen alle Schulkinder teilnehmen müssen), den Einschreibegebühren und den Studiengebühren für die Universitäten. Die Kosten steigen mit dem ranking der Schulen/Universitäten, ein besonders guter ist auch ein besonders teurer Abschluß.
- Hohe Preise für Wohneigentum. Der Erwerb von Wohneigentum ist auch Teil der Alterssicherung, da die Leistungen der Sozialversicherung in der Regel nicht ausreichen, um einen akzeptablen Lebensstandard und die Miete zu finanzieren.
- Unzureichende Alterssicherung. Sie zwingt, auch privat durch Ersparnisbildung für das Alter vorzusorgen.
- Die Rolle der Bonuszahlungen. Ein großer Anteil (bis zu 40%) der japanischen Arbeitnehmereinkommen besteht aus zweimal jährlich erfolgenden Bonuszahlungen, die meist nicht in den laufenden Konsum eingehen, sondern gespart werden. Als Spezialfall der Bonuszahlungen wäre auch die betriebliche Abfindung bei Ausscheiden aus dem Beschäftigungsverhältnis zu erwähnen, die ebenfalls in der Regel gespart wird.
Die genannten Charakteristika erklären einen hohen Basisdruck zugunsten der Bildung von Ersparnissen. Sie erklären aber noch nicht, warum Unterkonsum bzw. Überersparnis gerade heute zu akuten Problemen werden. Eine hohe Spar- und eine dementsprechend niedrige Konsumquote war in den Jahren des wirtschaftlichen Aufholprozesses, als überdurchschnittlich hohe Investitionen finanziert werden mußten, funktional. Heute jedoch kann die Investition nicht so schnell wachsen, daß sie die gesamte inländische Ersparnis absorbiert (es sei denn, die Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse könnten ins Grenzenlose steigen). Selbst ein Null-Zinssatz reicht aber offensichtlich nicht, um die Ersparnis auf ein Niveau zurückzuführen, auf dem sie mit der Investition in Einklang gebracht werden kann (bzw. die Investition so anzureizen, daß sie die Ersparnis absorbiert). Die Ursache für die heute besonders geringe Sensibilität der Konsumenten/Sparer für den Zinssatz liegt in der Erwartung einer künftig rückläufigen Entwicklung sowohl der eigenen Einkommen als auch der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit insgesamt. Es handelt sich um eine grundlegende Verunsicherung, die auch dann, wenn die zugrunde liegenden Befürchtungen nicht die Realität widerspiegeln, die Kauf- und Sparentscheidungen steuern.
Die für den durchschnittlichen Arbeitnehmer wohl am schwersten wiegende Verunsicherung betrifft die Beschäftigung: Die lebenslange Beschäftigung und mit dem Dienstalter steigende Einkommen waren in der Vergangenheit die Grundlage für das Wirtschaften der Haushalte. Der Erwerb von Wohneigentum etwa, finanziert mit Krediten mit bis zu 30 Jahren Laufzeit, setzt stabile Einkommensverhältnisse voraus, ebenso die Ausbildung der Kinder. Die lebenslange Beschäftigung enthält zudem eine implizite Sicherung gegen Arbeitslosigkeit. Das japanische Beschäftigungssystem aber scheint zur Disposition gestellt zu sein: Die Stagnation der Wirtschaft wird in der Öffentlichkeit auch auf das Beschäftigungssystem bzw. das japanische Managementsystem insgesamt zurückgeführt. Das amerikanische Modell des "shareholder value" und des "hire and fire" wird als der überlegene Standard präsentiert, dem sich das japanische Management anzupassen habe. In der Realität halten sich Veränderungen zwar in Grenzen; sie beziehen sich in erster Linie auf die Senioritätslöhne, die zu Teilen durch Leistungslöhne ersetzt wurden (d.h. der Anteil der Seniorität als Determinante der Lohnhöhe ist rückläufig). Massenentlassungen haben die Unternehmen bislang vermieden. Er sind aber weniger nachweisbare Veränderungen als der befürchtete Verlust einer grundlegenden Sicherheit, der die Arbeitnehmer ihre Zukunft pessimistisch sehen und durch die Bildung von Ersparnissen für einen Notfall vorsorgen läßt, den es in der japanischen Realität bislang nicht gab: Arbeitslosigkeit. Angesichts unzureichender öffentlicher Sicherungssysteme (die staatliche Arbeitslosenversicherung zahlt Arbeitslosengeld für maximal 300, im Durchschnitt aber 60 Tage), ist das Steigen der Sparquote eine Reaktion auf das neue Risiko der Arbeitslosigkeit.
Die zweite Verunsicherung betrifft die Alterssicherung, die zum Problem wird, weil die indirekte Sicherung durch das Unternehmen (etwa auch durch Weiterbeschäftigung nach Erreichen des Pensionsalters, wenn auch zu verschlechterten Bedingungen) mit der eher perzipierten als realen Erosion lebenslanger Beschäftigungsverhältnisse in Frage gestellt ist. Die Alterssicherung ist ein besonderes Problem in einem Land, dessen Bevölkerung schneller altert als die jedes anderen Industrielandes. Das Thema der "Überalterung" besetzt in der öffentlichen Diskussion dauerhaft einen der ersten Plätze. Es gilt als ausgemacht, daß das bestehende System der Alterssicherung nicht wird gehalten werden können. Hierbei spielt eine Rolle, daß die staatliche Alterssicherung erst relativ spät (in den 70er Jahren) eingeführt wurde. Rentenansprüche haben nicht die Validität wie in der über hundertjährigen deutschen Sozialversicherung, und es gibt keine glaubwürdige politische Kraft, die die Interessen der aktuellen oder künftigen Rentner repräsentierte. Die Leistungen der staatlichen Alterssicherung sind zudem in der Regel nicht ausreichend, um ein Halten des Lebensstandards nach der Pensionierung zu gewährleisten. Die betriebliche Alterssicherung als komplementäres System hat mit der Diskussion um die lebenslange Beschäftigung ebenfalls an Glaubwürdigkeit verloren. Wichtiger ist, daß die Mittel der betrieblichen Pensionsfonds keinesfalls so angelegt sind, daß sie die Auszahlung der Leistungen im vereinbarten Umfang gewährleisten. Dasselbe gilt für die private Alterssicherung in der Form von Lebensversicherungen oder privater Vermögensbildung: Es gibt für japanische Sparer keine Anlagen, die bei einem akzeptablen Risiko akzeptable Erträge abwerfen. Es gibt nur, wie der Economist formulierte, sichere Anlagen mit Null-Erträgen oder hochriskante Anlagen mit Fast-Null-Erträgen.
Schließlich hat die Bankenkrise die Sparer/Konsumenten verunsichert. Sie hat aber nicht die Ersparnisbildung demotiviert, sondern den Übergang von weniger sicheren in sicherere Anlagen (von den privaten Banken zur Postsparkasse) bzw. den Rückzug von Anlagen aus dem Finanzsystem überhaupt. Viele Haushalte horten viele ihre Ersparnisse zu Hause, und die Hersteller von Safes gehören einer der wenigen boomenden Branchen an. Rückläufige Einlagen bei den Banken haben freilich negative Folgen für die Geldmenge, da die Geldschöpfung durch die Banken zum Teil neutralisiert wird. Die Bankenkrise hat neben ihrer realen Bedeutung für die Sparer auch eine politisch-symbolische Dimension: Sie zeigt die begrenzten Kapazitäten eines Staates, der sich in der Vergangenheit immer als Schutzherr der Wirtschaft und insbesondere des Finanzsektors präsentiert hatte. Die Möglichkeit, daß ein Unternehmen wie Yamaichi Securities bankrott gehen konnte, wirft ein Licht nicht nur auf das Finanzsystem, sondern auch auf die Schwäche des Staates.
Zusammengefaßt: Eine fundamentale Verunsicherung, die perzipierte Erosion der für die wirtschaftlichen Grundentscheidungen der Haushalte maßgebenden Rahmenbedingungen veranlassen die japanischen Sparer/Konsumenten zur exzessiven Ersparnisbildung bzw. behindern möglichen Konsum. Was aber wäre die angemessene wirtschaftspolitische Gegenstrategie? Die traditionelle Geldpolitik hat versagt. Die traditionelle keynesianische Fiskalpolitik hat möglicherweise Schlimmeres verhindert, sie hat aber nicht aus der Unterkonsumtion herausgeführt. Ein erheblicher Teil der staatlich geschaffenen Mehreinkommen werden nicht in den Konsum, sondern in die Ersparnis geflossen sein. Dies gilt insbesondere für die angekündigten Steuererleichterungen, die das verfügbare Einkommen der Haushalte 1998 im Durchschnitt um umgerechnet DM 900 ansteigen lassen werden. Umfragen zeigen bereits heute, daß dieses Mehreinkommen die Haushalte nicht zu einer Veränderung ihres Konsum- und Sparverhaltens veranlassen wird (auch Comicstrips des Finanzministeriums, die zu mehr Verbrauch anregen, werden eher das Gegenteil bewirken). Vor allem aber tendiert die keynesianische Fiskalpolitik indirekt auch dazu, die Verunsicherungen zu stärken, die der Unterkonsumtion zugrunde liegen, da mit dem anschwellenden staatlichen Haushaltsdefizit (bzw. der öffentlichen Debatte hierüber) zum einen die Funktionsfähigkeit der staatlichen Leistungssysteme (in erster Linie der staatlichen Rentenversicherung) in Frage gestellt und zum andern die Erwartung einer künftig restriktiven Politik mit negativen Folgen für Einkommen und Beschäftigung geschürt wird.
Damit bleiben zwei weitere Politikansätze: Wirtschaftliche Strukturreformen (Deregulierung) und eine nicht-konventionelle Geldpolitik. Strukturreformen und Deregulierung werden seit Jahren gefordert. Die japanische Wirtschaft weist eine Fülle von Rigiditäten auf, die abgebaut werden können und müssen. Eine konsequente Deregulierung könnte zur Steigerung der Produktivität und zum Sinken der Preise führen, sie würde die Angebotskapazität der japanischen Wirtschaft erheblich verbessern, das heute akute Problem liegt aber, wie erwähnt, nicht auf der Angebots-, sondern auf der Nachfrageseite. Reform- und Deregulierungsvorschläge müßten also den Nachweis enthalten, ob und welchem Umfang sie zur Belebung der Konsumentennachfrage beitragen. Natürlich gibt es Spielräume für entsprechende Maßnahmen, insbesondere wenn sie sich auf die benannten institutionellen Faktoren beziehen, die eine kontinuierlich hohe Sparrate erzwingen: Das Ausbildungssystem, den Erwerb von Wohneigentum und die Alterssicherung. Reformen in diesen Bereichen, die auf jeden Fall angemessener wären als der Brücken- und Tunnelbau ohne Grenzen, können aber nur langfristig realisiert werden.
Schließlich sei eine nicht-konventionelle Geldpolitik erwähnt, wie sie Paul Krugman vorschlägt: Unter bestimmten Bedingungen, die für Japan gegeben zu sein scheinen - d.h. einer aus demographischen und anderen Gründen langfristig rückläufigen volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit - ist der Zinssatz, der einen Ausgleich von Ersparnis und Investition herstellt, negativ. Da der nominale Zinssatz nicht negativ sein kann, sind die Möglichkeiten der konventionellen Geldpolitik begrenzt. Diese injiziert der Wirtschaft immer neue Liquiditätsspritzen und erhöht auf diese Weise diskontinuierlich die Geldmenge, aber mit dem Effekt, daß die entsprechenden Zuwächse gespart werden und nicht in den Konsum gehen. Wenn eine Senkung der Sparrate auf das von der Investition zu absorbierende Niveau nur durch einen negativen Zinssatz bewirkt werden, der nominale Zinssatz aber nicht unter Null liegen kann, muß der reale Zinssatz unterhalb der Nullgrenze liegen, d.h. die Sparer/Konsumenten müßten steigende Preise, also Inflation antizipieren. Die Zentralbank müßte deutlich machen, daß sie von ihrem traditionellen Kurs abgehen, auf steigende Preise nicht restriktiv reagieren und Inflation in Kauf nehmen wird. Die konventionelle Geldpolitik greift gerade deshalb nicht, weil die Zentralbank der Preisstabilität als oberstem und langfristigem Ziel verpflichtet ist. Notwendig wäre eine Zentralbankpolitik, die glaubhaft versprechen könnte, im herkömmlichen Sinne "unverantwortlich" zu handeln. Es ist nicht wahrscheinlich, daß sich die Bank of Japan zu einer Politik durchringen kann, die derart gegen die konventionellen Regeln verstieße.
Die Bankenkrise: Moral Hazard
Die Asienkrise hat ein neues Licht auch auf die japanische Bankenkrise geworfen. Als wichtigste Ursache der asiatischen Währungskrisen wurde das "moral-hazard"-Verhalten sowohl lokaler Banken als auch internationaler Geldgeber identifiziert. Lokale und internationale Banken konnten davon ausgehen, daß ihr Kreditrisiko politisch gedeckt war, lokal durch die jeweiligen Regierungen und Zentralbanken, international durch den IWF. Die Deckung von Kreditrisiken durch die Steuerzahler (nach dem Motto: Entweder gewinne ich oder der Steuerzahler zahlt) zwingt - wie Paul Krugman anhand der asiatischen Finanzsysteme analysiert hat - unter Wettbewerbsbedingungen zu riskanten Investitionsentscheidungen, die zur Überinvestition und zu steigenden asset-Preisen führen.
Die Kreditpolitik der japanischen Banken in den Jahren der "bubble economy" läßt sich mit dem Muster des "moral hazard" beschreiben - mit dem freilich wichtigen Unterschied, daß in Japan keine externen Mittel involviert waren und der ganze Prozeß eine innere Angelegenheit blieb. Die Banken bewerteten die Risiken ihrer Kreditinvestitionen niedrig, weil sie davon ausgehen konnten, daß sie letztlich durch Zentralbank und Staat vor dem Bankrott geschützt waren. Die berühmte Geleitzug-Politik des Finanzministeriums, bei der im Krisenfall größere Banken für kleinere und der Staat für die größeren Banken aufkommen, reduzierte das Bankrottrisiko in den Augen der Akteure de facto auf Null. Das Ergebnis waren hochriskante Investitionen in Immobilien- und Aktienspekulation, Überinvestition und ins Astronomische steigende Aktien- und Immobilienpreise.
Für die Entwicklung nach dem Platzen der derart aufgeblasenen "bubble" war die Logik der staatlichen Risikogarantie von entscheidender Bedeutung: Die offizielle Garantie ist nur so lange wirksam, wie sie nicht eingelöst werden muß. In dem Augenblick, in dem der Staat in einem größeren Umfang seine Garantien einlösen und gescheiterte Banken auskaufen muß, in dem also auch die Kosten des "moral hazard" sichtbar werden, bricht das System der Deckung privater Kreditrisiken zusammen. Nicht nur werden die nun nicht mehr gedeckten Verluste der Banken sichtbar, sie erweisen sich auch als weit größer als sie unter normalen Bedingungen gewesen wären.
In Japan erfolgte dieser Zusammenbruch nicht auf einen Schlag, sondern verlief in der Form einer schleichenden Erosion. Noch 1995/96 verfolgte der Staat eine ambivalente Politik. Auf der einen Seite bestätigte er seine Garantie, indem er - gegen starken öffentlichen Protest - die Investoren in sieben größere Hypothekenbanken mit Steuermitteln auskaufen ließ. Gleichzeitig ließ das Finanzministerium jedoch zu, daß mehrere Kreditgenossenschaften bankrott gingen. Das Publikum sah hierin keinen grundlegenden Wandel, da es sich um kleinere Institute handelte, deren Management eine gewisse kriminelle Energie entwickelt hatte. Mit der Zeit wuchs jedoch die Größe der privaten Finanzinstitutionen, die pleite gingen, ohne daß der Staat intervenierte: Den Kreditgenossenschaften folgten kleinere und mittlere Banken, Regionalbanken, eine Lebensversicherung, die zehntgrößte Geschäftsbank Japans und schließlich, im Herbst 1997, Yamaichi Securities, das viertgrößte Wertpapierhaus des Landes. Der Bankrott von Yamaichi hatte unter den gegebenen Bedingungen nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine symbolische Bedeutung: Er signalisierte das Ende der staatlichen Bestandsgarantie für die privaten Finanzinstitute.
Gleichzeitig führte das Finanzministerium neue Regulierungen ein, die den international operierenden Banken einen Eigenkapitalanteil von 8% und den national operierenden Banken von 4% abverlangten. Dies bedeutete, daß die Eigner der Banken gezwungen wurden, einen Teil der Kreditrisiken zu tragen. Da die international operierenden Banken (deren Zahl seit 1996 von 80 auf 45 zurückgegangen ist) aufgrund der Anforderungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ohnehin 8% Eigenkapital nachweisen müssen, trafen die neuen Regeln vor allem kleinere und schwächere Banken, Regionalbanken und Kreditgenossenschaften. Beides, die symbolische Aufkündigung der staatlichen Bestandsgarantie für private Finanzinstitute und die Einführung der neuen Regel, führte dazu, daß die vorher extrem risikofreudigen Banken nahezu über Nacht extrem risikoscheu wurden. Das Ergebnis war der Kollaps der finanziellen Vermittlungsfunktion der Banken, ein "credit crunch", der seit Ende 1997 vor allem kreditabhängige kleine und mittlere Unternehmen reihenweise zusammenbrechen ließ. Erst jetzt, sieben Jahre nach dem Platzen der "Seifenblase", bekam der Rest der Volkswirtschaft das volle Gewicht der Bankenkrise zu spüren.
Anfang 1998 legte die Regierung ein neues Sanierungsprogramm für die Banken auf: Nicht zuletzt unter internationalem Druck stellte sie 30 Billionen Yen als Sicherheit zur Verfügung. Sie stellte auf den ersten Blick die staatliche Garantie für die Banken wieder her, die mit dem Zusammenbruch von Yamaichi aufgekündigt worden war. Die beschriebene Sequenz: - staatliche Garantien für das Finanzsystem - "moral hazard" der Banken - Aufblasen und Platzen der bubble - einmalige Einlösung und folgende Aufhebung der Garantien - Kollaps der finanziellen Vermittlungsfunktionen der Banken und Kreditverknappung - war ein Kreislauf geworden. Mehr noch: Die Garantie ist nicht mehr implizit, sondern explizit und mit einer präzisen Zahl versehen: 30 Billionen Yen. Zwar soll die Vergabe von Mitteln an die Banken mit Auflagen wie Restrukturierungsmaßnahmen, Zusammenschlüssen, Gehalts- und Beschäftigungsabbau, Verkleinerung des Managements (viele der berühmten "senior advisers" mußten ihren Job aufgeben) usw. versehen werden. Es ist jedoch mehr als fraglich, ob dieselben staatlichen Aufseher, die - in Erwartung einer lukrativen Stellung in einer Privatbank nach der Pensionierung - die Praxis des "moral hazard" jahrelang gedeckt hatten, nun plötzlich zu unbestechlichen Hütern finanzieller Disziplin werden können.
Es ist jedoch auch zu berücksichtigen, daß es sich bei der Bereitstellung der 30 Billionen um eine Notmaßnahme handelt, die verhindern soll, daß der kreditabhängige Teil der Wirtschaft - die kleinen und mittleren Unternehmen, die über 80% der Beschäftigung des Landes ausmachen - zusammenbricht. Der ordnungspolitisch korrekten Annahme, das Spiel der Marktkräfte werde die notwendige Sanierung des Bankensystems wirksamer bewerkstelligen als staatliche Mittel und diskreditierte Aufseher, müssen die volkswirtschaftlichen Kosten gegenübergestellt werden, die die weitere drastische Verknappung des Kredits mit sich brächte. Darüber hinaus bringt gerade die explizite Formulierung einer Garantie einschließlich einer genauen Zahl ein quasi-vertragliches Element in die Beziehungen zwischen Staat und Banken. Hatte die Geleitzug-Politik Sicherheit suggeriert, ohne daß diese in irgendeiner Form niedergelegt worden und einklagbar gewesen wäre, so gewährt das 30-Billionen-Programm nicht nur eine Hilfe, sondern gibt auch deren Grenze an. Der Staat verhält sich Banken gegenüber nicht mehr als "lender of last resort", sondern eher wie der IWF gegenüber Krisenländern, dessen Mittel begrenzt sind und nur gegen die Auflagen gewährt werden.
Schließlich ist darauf zu verweisen, daß nicht nur der Zusammenbruch von Yamaichi einen ordnungspolitischen Schock ausgelöst hat, der zunächst einmal verhindern wird, daß das 30-Billionen-Sanierungsprogramm nur als Wiederherstellung der alten Verhältnisse wahrgenommen wird. Dem Yamaichi-Schock fügt sich ein zweiter, intendierter Schock hinzu: Die mit dem Etikett "Big Bang" versehene Deregulierung und Öffnung des Bankensystems bis zum Jahre 2001. Man mag darüber streiten, wie ernst es der Regierung mit der Deregulierung und Öffnung wirklich ist; aber es ist absehbar, daß die staatliche Reform einen Prozeß beschleunigen wird, der bereits in Gang gesetzt wurde: Die zunehmende Konkurrenz ausländischer Banken, Investmentbanken und Wertpapierhäuser um die 12 Billionen US$ japanischer Ersparnisse (1997 hatten ausländische Wertpapierhäuser den japanischen "Großen Vier" bereits den Rang abgelaufen). Dabei werden ausländische Banken und Wertpapierhäuser eine besonders prominente Rolle bei der Anlage japanischer Ersparnisse im Ausland spielen - eine Anlageform, die aufgrund administrativer Hürden und der in der Vergangenheit kontinuierlichen Aufwertung des Yen bislang von vergleichsweise wenig Anlegern genutzt wurde
Politik und Bürokratie: Wer regiert Japan heute?
Auf die Frage: Wer regiert Japan? hätte man bis vor kurzem den Hinweis auf die Bürokratie erhalten. In den 60er und 70er Jahren hatte das MITI als Kommandohöhe der Administration gegolten, seit den 80er Jahren das Finanzministerium. Diese Antwort war nie ganz richtig, enthielt aber einen richtigen Kern: In allen Fragen, die nicht die unmittelbaren wahlpolitischen Interessen der Politiker betreffen, verfügen einige Ministerien über für eine Demokratie unüblich hohe Autonomie. Dies impliziert eine Aufteilung der Ministerialbürokratie im Hinblick auf die Nähe zu den wahlentscheidenden Themen: Die Ministerien für Bau, Landwirtschaft und Transport sind "politische" Ministerien, weil sie bei der Verteilung öffentlicher Mittel in den Wahlkreisen eine Schlüsselstellung innehaben. Das MITI und das Ministerien für Finanzen dagegen sind für die direkte Bedienung der Wahlkreise weniger wichtig, sie haben keine spezifische Klientel, die für die Wahlchancen der LDP-Politiker von Bedeutung wäre (zwei Ausnahmen sind der Einzelhandel, für den das MITI zuständig ist, sowie lokale Banken und Kreditgenossenschaften, die in der Zuständigkeit des Finanzministeriums liegen. In beiden Fällen haben sich immer die Politiker gegen die technokratischen Positionen der Bürokratie durchgesetzt). MITI und Finanzministerien konnten weitgehend unabhängig regieren, so daß das Bild eines technokratisch gelenkten Japan die Realität halbwegs angemessen wiedergab. Die technokratische Autonomie wurde durch die Arbeitsteilung innerhalb der LDP unterstrichen: Während sich die Mehrheit der LDP-Hinterbänkler um das Wohlergehen ihrer lokalen Klientel bemühte, war und ist es Aufgabe der Parteizentrale, das Mosaik partikularer Lokalinteressen durch Politik auf nationaler Ebene zu ergänzen. Es gab daher immer eine gewisse Interessenübereinstimmung zwischen den beiden wichtigsten Ministerien und der LDP-Parteiführung.
Die Politiker gingen allerdings nie so weit, ihre Entscheidungsgewalt völlig aus der Hand zu legen: Sie verweigerten der Bürokratie die gesetzlichen Zwangsmittel, ihre Initiativen auch gegen den Willen der Regierten durchzusetzen. Die Gesetze sind meist vage formuliert bzw. fehlen völlig, so daß die Bürokratie auf der einen Seite über einen sehr großen Ermessensspielraum verfügt. Auf der anderen Seite jedoch fehlt es an rechtlichen Instrumenten, diese Spielraum auch zu nutzen. Die Bürokratie ist auf Konsens mit den privaten Akteuren angewiesen. Öffentliche Politik wird daher in einem kontinuierlichen Verhandlungsprozeß entwickelt, in dem die jeweils geltenden Regeln immer neu definiert und interpretiert werden müssen. Das oft bewunderte japanische Konsensmodell basiert auf dem Zwang zur kontinuierlichen wechselseitigen Rückversicherung der Verwaltenden und der Verwalteten, dem das Fehlen klarer rechtlicher Regeln zugrundeliegt. Dieser Prozeß vollzieht sich informell, vermittelt durch persönliche Beziehungen. Die Informalisierung und Personalisierung der Beziehungen zwischen Bürokratie und privaten Unternehmen kompensiert die schwache Entwicklung des Rechtssystems, das in Japan nicht als normale Instanz zur Klärung von Rechten und Ansprüchen genutzt, sondern nur in extremen Ausnahmesituationen angerufen wird. Selbst wenn Rechte und Ansprüche präzise definiert wären, würde deren praktische Durchsetzung an der Schwäche der Judikative scheitern. Es gibt in Japan viel zu wenig Richter und Anwälte - die Zahl der pro Jahr neu zugelassenen Anwälte ist auf exakt 700 festgelegt -, und Prozesse sind zu teuer und zu langwierig, um die Rechtssphäre zu einer effizienten Klärungsinstanz zu machen. Konsensbildung als Ersatz einer rechtlichen Klärung findet in einer Grauzone statt, in der das Verhalten der Beamten nach westlicher Auffassung oft der Korruption nahekommt. Korruption im strengen Sinne freilich würde die klare Trennung zwischen öffentlichem und privaten Bereich voraussetzen, die es nicht gibt.
Im Zentrum jüngster Korruptionsskandale standen das Finanzministerium und die Zentralbank. In der Regel ging es darum, daß Beamte von privaten Banken aufwendig bewirtet wurden und als Gegenleistung vertrauliche Informationen, etwa den Zeitpunkt einer Bankinspektion oder eine geplante Veränderung des Zentralbankzinssatzes, preisgaben. Eine Abschottung der öffentlichen Entscheidungsbildung gegenüber dem privaten Sektor kann es aber im japanischen System gar nicht geben, da die öffentlichen Entscheidungen im informellen Konsens mit den privaten Akteuren gefällt werden. Auffällig ist daher weniger, daß sich japanische Beamte im westlichen Sinne inkorrekt verhalten haben, als daß - für viele Beamten selbst nicht vorhersehbar - plötzlich eine Praxis öffentlich angeprangert wird, die bislang als normal galt. Eine effiziente Regulierung des Bankensystems, so ein Spitzenbürokrat, der jüngst zurücktreten mußte, setzt enge und d.h. persönliche Beziehungen zu den Vertretern der privaten Unternehmen voraus, die bei den nun inkriminierten Bewirtungen gepflegt wurden.
Die Korruptionsskandale der Bürokratie zeigen nicht, daß eine einst untadelige Verwaltung durch den Verlust moralischer Maßstäbe korrupt geworden wäre, sie zeigen, daß sich die Maßstäbe verschieben müssen, an denen korrektes oder korruptes Verhalten zu messen ist. Wenn das japanische Bankensystem reformiert werden soll, dann dürfen die Vertreter der privaten Banken nicht mehr darauf hoffen können, daß sie im Zweifelsfall ihre Probleme über den direkten persönlichen Kontakt mit dem zuständigen Beamten regeln, und die Beamten dürfen nicht mehr als selbstverständlich voraussetzen, daß sie ihren Vorstellungen im Sushi-Restaurant Geltung verschaffen. Die Verschiebung der Maßstäbe selber verläuft freilich in einer Form, die wenig hoffnungsfroh stimmt: in der Form der öffentlichen und symbolischen Kriminalisierung einer bislang normalen Praxis (die symbolische Bestrafung von 112 Finanzbeamten wird ganz offen als Lehre für die jüngeren Bürokraten gerechtfertigt), ohne daß die Grundlage einer transparenten (und anfechtbaren) öffentlichen Entscheidungsbildung - eine klare Zuweisung von Ansprüchen und Rechten und ein funktionierendes Rechtssystem zu deren alltäglicher Durchsetzung - geschaffen worden wäre. Dies freilich wird kaum in einem einmaligen Akt - etwa durch die Verabschiedung neuer Gesetze -, sondern nur in einem langwierigen Prozeß erfolgen können, in dem die bisherige Diskriminierung des Rechts als Klärungsinstanz abgebaut wird.
Die notwendige Reform des Finanzsystems wird in der gegenwärtigen Situation eher zu einem Spielball machtpolitischer Auseinandersetzungen sowohl innerhalb der Finanzbürokratie (hinter den jüngsten Säuberungen im Finanzministerium, die fast ausschließlich das Banking Bureau trafen, wird das mächtige Budget Bureau vermutet) als auch zwischen LDP-Politikern und Bürokraten. Dieser Machtkampf hat zu einer Paralyse der Finanzbürokratie geführt: Die quälenden und langwierigen Auseinandersetzungen, deren es bedurfte, um die Entscheidungen zu einer neuen Konjunkturspritze bzw. zur Sicherung des Bankensystems zu treffen, signalisieren, daß in einem der wichtigsten Segmente der japanischen Verwaltung die routinierte Bewältigung von Problemen empfindlich gestört ist. An der Stelle, die einst als Kommandohöhe der Japan AG gelten konnte, hat sich ein Vakuum aufgetan, das nun die LDP-Politiker zu füllen versuchen. Die Politiker verfügen aber unabhängig von der Verwaltung über keine Expertise; es gibt keine von der Bürokratie unabhängigen "think tanks", die Strategien entwerfen und die Politik beraten könnten. Sie okkupieren ein Gelände, das sie nicht kennen. Ihre Initiativen reduzieren sich darauf - das Regierungprogramm des neuen Premiers Obuchi zeigt dies überdeutlich -, der Konvention zu genügen und zu wiederholen, was als "common sense" gilt - eine schlechte Voraussetzung zur Bewältigung einer alles anderen als konventionellen Krise.

© Friedrich Ebert Stiftung | technical support | net edition bb&ola | November 1998
